KV-Handbuch (1957)
KV-HANDBUCH Herausgegeben im Auftrag des Kartellverbandes katholischer deutscher Studentenvereine (KV) von Dr. phil. Paul Benkart 1957
Kommissionsverlag: Verband alter KVer e.V. Geschäftsstelle: Beckum Bez Münster
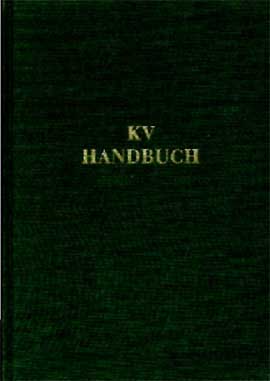
Vorwort
Für ein Handbuch in des Wortes rechter Bedeutung wurden die vorliegenden Arbeiten angefertigt. Jedem Kartellangehörigen, in Studium und Beruf, soll es zur Hand sein als Anregung und Hilfe für das persönliche Leben wie für das Leben der Gemeinschaft. Darum ist zunächst von Lebensräumen des katholischen Akademikers die Rede: Universität bzw. Hochschule, Staat und Kirche. Auch der KV weiß sich den drei Gesellschaftsgebilden zugeordnet. Füglich schließen sich den Erörterungen über die Lebenskreise die Kapitel zur Erhellung seines Wesens an. Dem Verständnis seines Weges in der Vergangenheit und seiner Entfaltung in der Gegenwart gelten die weiteren Beiträge der Mitarbeiter. Aus den Äußerungen der Gründer und der Träger der Überlieferung wird, so hoffen wir, das Maßgebende erschlossen und sichtbar gemacht.
Wenn der Leiter des Religiös-Weltanschaulichen Amtes des KV die Herausgabe übernommen hat, so läßt sich das vom Amte her rechtfertigen. Weltanschauung besagt: Den Blick auf die Welt richten unter dem Gesichtswinkel des Verhaltens zu ihr. Zu dem geforderten Überblick aber gelangt der Mensch erst von einem weltüberlegenen Standpunkt aus. Auf den erhöhten Standort erhebt allein die Kirche, die mit der alles umfassenden Übersicht Christi die Welt anschaut und mit seinen Maßen mißt. Mithin erwächst auch das Selbstverständnis des KV, alle seine Lebensäußerungen einbegriffen, aus religiöser Weltanschauung. Es nimmt darum nicht wunder, daß die Bildungsarbeit des Verbandes dem RWA übertragen ist. Das vorliegende Handbuch wagt den Versuch, mit all den anhaftenden Mängeln, Werden und Wirken des KV, die Besonderheit seiner Art in den Blick zu geben, das Gewissen zu schärfen und kraftvolle Liebe und Treue zum Verband zu wecken bzw. aufzufrischen. Klar erkennbar werde die Bedeutung des Verbandes, der über die Korporation hinaus bis zum Lebensende Heimat gibt und deshalb größeren Raum im Herzen des KVers einnehmen muß. Vor allem heißt es, den Verband als eine ernste Aufgabe zu werten. Dem Leiter des KV-Sekretariates, Kb AH Studienrat i. R. W. Hünnes, seinem Interesse und ständigem Drängen, ist es zu verdanken, daß dies Buch nunmehr erscheint; allerdings unter Berücksichtigung dessen, daß das Bessere oft der Feind des Guten ist. Abschließend sei die Erwartung ausgesprochen, daß diesem mehr allgemein gehaltenen Handbuch Arbeiten folgen, die sich mit konkreten Lebensfragen und Verhaltensweisen der Korporation bzw. des Verbandes befassen.
Paderborn, Ostern 1957
Der Herausgeber
Zum Geleit
Zu den überraschenden Tatsachen unserer Nachkriegsentwicklung gehört, daß die großen deutschen Studentenverbände sich ihren Platz an den deutschen Universitäten und Hochschulen wiedererobern konnten. Dies war um so erstaunlicher, als sie sich nicht nur gegen die herrschende öffentliche Meinung, sondern weithin auch gegen die Spitzen der akademischen Selbstverwaltung durchsetzen mußten. Dieser Kampf kann im wesentlichen als abgeschlossen gelten. Um so bedeutsamer bleibt die von der Öffentlichkeit zu Recht gestellte Frage, wie diese Verbände mit ihrer Vergangenheit und ihrer Tradition fertig werden. Manchem mag scheinen, daß die christlichen Studentenverbände von dieser Fragestellung weniger berührt werden. Und dies trifft in der Tat für unseren KV auch zu.
Die Korporationen unseres Verbandes und die Kartellangehörigen standen und stehen auf dem Boden des katholischen Glaubens. Diese Grundlage ist unantastbar, mögen die uns umgebenden politischen, sozialen und geistigen Veränderungen noch so tiefgreifend sein. Politisch hat sich unser Verband schon eindeutig zum Staat von Weimar bekannt, so wie er sich heute ebenso vorbehaltlos zur Demokratie bekennt. Gemäß der Lehre der Kirche hat er Duell und Mensur abgelehnt, die die Öffentlichkeit erregende Frage des Farbentragens hat ihn nicht betroffen. Dagegen steht er mit allen deutschen Korporationsverbänden in einer Reihe, wenn es um das Bemühen geht, die bündisch-korporative Lebensform und die mit dieser Lebensform notwendigerweise verbundene echte studentische Selbstverwaltung zu verteidigen. Dasselbe gilt für das Bemühen des gesamten Korporationsstudententums, zu zeitgemäßen Lebensformen zu kommen, die vor der politischen und sozialen Wirklichkeit der Gesamtnation zu verantworten sind.
In diesem Handbuch wird der Versuch gemacht, einige wesentliche Aussagen zu machen, die uns in der gegenwärtigen Situation wichtig scheinen. Niemand wird erwarten, daß in Bezug auf die umstrittenen studentischen Lebensformen Aussagen gemacht werden können, die Anspruch darauf erheben, die Meinung des Verbandes wiederzugeben. Es sei vielmehr ausdrücklich festgestellt, daß die einzelnen Mitarbeiter hier ihre rein persönliche Auffassung wiedergeben, eine Tatsache, die unseren herzlichen Dank an Herausgeber und Mitarbeiter nicht zu schmälern braucht.
Dr. Paul Franken
Vorsitzender des KV-Rates
PAPST PIU5 XII.
DAMALS APOSTOLISCHER NUNTIUS IN DEUTSCHLAND
hielt am 30. Mai 1928 auf dem Festkommers der KV- Korporationen Askania und Burgundia anläßlich
des 75jährigen Stiftungsfestes bei der Annahme der Ehrenmitgliedschaft der Askania folgende Ansprache
Sie haben mich soeben als Ehrenmitglied in Ihre Familie freundlichst aufgenommen. Nehmen Sie dafür meinen verbindlichsten und herzlichsten Dank entgegen! Am heutigen Jubiläumstage geleitet Sie Ihr Verband durch die eigene Ahnenreihe, durch die stattliche Zahl aller derer, die Sie mit Stolz und Ehrfurcht nennen, und um die sich, wie überhaupt um die führenden Männer in den katholischen Studentenverbänden, ein gutes Stück der Geschichte des katholischen Lebens im Deutschland der letzten hundert Jahre webt. Wenn ich diese Ahnenbilder an meinem Blicke vorüberziehen lasse, so sind es zwei Charakterzüge, die, bei allem Reichtum der persönlichen Eigenart, diese Männer doch als Söhne derselben Familie, als beseelt von derselben Lebensidee erweisen: Ihre Männer waren Männer des Volkes. Sie haben gebetet, gearbeitet, gekämpft für ihr Volk und mit dem vollen Bewußtsein ihrer Verantwortung für das Volk. Sie kennen das Wort der alten Zeit: Adel verpflichtet. Ergänzen Sie es durch das andere Wort, das immer gegolten hat und heute eine Ihrer heiligsten Pflichten ausspricht, das Wort: Bildung verpflichtet. Ihre höhere Bildung verpflichtet Sie dem ganzen Volke, dem einfachen Volke gegenüber, heute mehr denn je! Ihre Väter stehen sodann vor Ihnen als Männer, die mit ihrem ganzen Wesen in der katholischen Weltanschauung verwurzelt waren. Die neue Zeit, die Zeit der Offenbarung der materiellen Kräfte, aber auch die Zeit der Umwertung aller ideellen Werte, braust wie ein Orkan über die Völker dahin und droht sie gleichsam dem Boden zu entreißen, aus dem sie herausgewachsen sind. Ich sehe in den vielen Gedenkfeiern unserer Tage, in dieser ständigen Rückschau, die Angst des Menschen von heute vor dieser Entwurzelung, sein instinktives Bestreben, das wirklich Wahre und Wertvolle der Vergangenheit in die neue Zeit herüberzuretten. Wir Katholiken haben der Zukunft die besten Werte der Vergangenheit, die absoluten, in Gott verankerten, darum der Menschheit jederzeit unentbehrlichen, Leben, Glück und Frieden der Völker in ihrem Schoße tragenden Werte zu übermitteln. Aus dieser Überzeugung heraus haben sich Ihre Väter so mannhaft für ihren Glauben, für die heilige Kirche, für die Durchdringung des ganzen, auch des sozialen und politischen Lebens mit deren Anschauungen und Grundsätzen, eingesetzt. Das ist die Aufgabe, die sie Ihnen hinterlassen haben. Erfassen Sie diese Aufgabe in kindlicher Liebe und gläubigem Vertrauen gegenüber dem Stellvertreter Christi auf Erden, mit der vollen Kraft Ihrer Überzeugung und mit der ganzen Glut Ihres Herzens. Sie sind als die am meisten Mitverantwortlichen für Kirche und Volk hineingestellt in Jahre der Entscheidung, wie sie der tausendjährige Lauf der Geschichte nur selten gesehen hat. Aus Ihnen allen katholische Männer zu schaffen, die durch Sein und Tat, durch Wort und Beispiel für die Erhaltung der höchsten Volksgüter, der katholischen Lebenswerte eintreten, das ist das Wesensziel, das sich Ihr Verband gestellt hat, das Wesensziel, das sich alle katholischen Studentenverbände und Bünde der studierenden Jugend stellen müssen. Gott segne Ihren Verband, damit er sein Lebensideal einmal an Ihnen vollkommen verwirklicht sehen möge.
Lebensräume des katholischen Akademikers
Die Universität als Gabe und Aufgabe
-><- Karl Vossschulte Unsere Vorstellungen von der Universität wurzeln in dem Begriff der universitas litterarum, d. h. einer Gesamtheit der Wissenschaften und der Gelehrsamkeit. Die Universität ist also nicht eine Einrichtung, die nur das vorhandene Wissen, die gewonnene Erkenntnis für den Studenten als Gabe bereithält, sondern die Stätte, die wissenschaftliche Arbeit, d. h. Erforschung des Unbekannten pflegt, um aus den Ergebnissen dieser Aufgabe stets neues Rüstzeug für das Lehramt zu gewinnen. Diese Bestimmung ist Grundlage aller Universitäten. Sie gilt heute wie früher und wird ihren Wert behalten.
Wer hat als Student darüber nachgedacht, welche Kräfte vorhanden sein müssen, um eine Universität zu schaffen und zu tragen und woher die Mittel kommen, um sie zu erhalten? Als Gabe haben wir sie in unserer Studentenzeit kaum empfunden. Wir haben sie als selbstverständliche Einrichtung des Staates oder der Öffentlichkeit hingenommen. Als reifer Mann sieht man tiefer und erkennt, daß die Universität ein Geschenk des Volkes ist, das man nur mit der Verpflichtung zur Rückerstattung hinnehmen darf.
Die akademische Lehre hat ihre Grundform durch alle Zeiten bewahrt. Die Universität ist „Alma Mater" geblieben. Alles, was sie zu geben vermag, bietet sie mit größter Freigebigkeit an wie vor Jahrhunderten. Aber der Wissensreichtum, den sie zu spenden vermag, ist dem einzelnen Studenten auch nicht annähernd mehr zugänglich. Das ist übrigens früher ähnlich gewesen. Mephistopheles fordert in Fausts Gewand den Famulus eindringlich auf: „Doch wählt mir eine Fakultät." Der Student hat sich immer für ein Fach entscheiden müssen, aber er fand in früheren Jahrhunderten Zeit, geistige Anregung auch auf anderen Gebieten von der Universität zu empfangen; es blieben ihm Mußestunden, um nach seiner Neigung aus der „universitas litterarum" zu schöpfen, die die Universität in übervollem Maß stets anzubieten hatte. Die moderne Zeit erfordert einen anderen Maßstab.
Der der Berufsausbildung dienende Unterricht nimmt dem Studenten unserer Tage die Möglichkeit, anderen Bildungsinteressen nachzugehen, weil die Zeit nicht mehr ausreicht und die Anforderungen an die geistige Kapazität das tragbare Maß zu überschreiten drohen.
Wenn der Student sich unter solchen Bedingungen auf sein Berufsziel vorbereiten muß und kaum die von der Fakultät angebotenen Gaben zu bewältigen vermag, wie soll er dann zur universitas litterarum vorstoßen? Kann die Universität ihm dazu noch helfen? Die Frage muß heute mit aller Entschiedenheit verneint werden. Daran ändern auch nichts die Versuche, die Allgemeinbildung unserer Jugend durch Studium universale, Studium generale und dergl. zu fördern. In diesen Bezeichnungen dokumentiert sich ein Irrtum. Unter Studium kann man nur das heiße Bemühen verstehen, das aufgewandt wird, um ein Gebiet geistig zu durchdringen. Die Grenzen des menschlichen Verstandes verhindern eine universelle oder generelle Ausdehnung dieses Vorhabens. Mit dem Studium generale überträgt man der Universität Aufgaben, die sie in der Lehre leicht meistern kann, aber der Erfolg muß scheitern, weil der Apperzeption des Lernenden Grenzen gesetzt sind.
Etwas ganz anderes ist die Allgemeinbildung, als deren Maß uns die Summe alles im Augenblick verfügbaren Wissens gilt. Diese Basis ist unter dem Einfluß unserer Zeit mit ihren spezialisierten Aufgaben schmaler geworden. Das wäre wohl zu vermeiden gewesen, wenn man nicht auf den Gedanken gekommen wäre, der Universität zuzumuten, nachzuholen, was auf den höheren Schulen versäumt wird. Was mit der Einführung des Studium generale beabsichtigt wurde, die Allgemeinbildung unserer akademischen Jugend zu verbessern, gehört in den Lehrplan der höheren Schule. Sie bietet die letzte Möglichkeit, die Grundlagen für eine umfassende Allgemeinbildung zu schaffen. Die Universität dagegen kann jetzt nur noch dem Studium speciale dienen, der Ausbildung im erwählten Beruf. Sie vermag zwar wesentlich mehr herzugeben, aber der Student kann es nicht mehr studieren, sondern höchstens noch hören und hinnehmen, mag das Interesse noch so groß sein. Was mit solchen Vorlesungen und Vorträgen aus anderen Wissensgebieten erzielt wird, entspricht dem Ertrag, dessen jeder allgemeinverständliche Vortrag (Volkshochschule und dergl.) sicher sein kann. Der Gewinn für den Studenten steht in keinem Verhältnis zu Mühen und Aufwand. Das geistige Fassungsvermögen des Studenten wird für die Berufsausbildung voll beansprucht. Wer das leugnen möchte, der besuche einmal die Durchschnittsvorlesungen, die im Rahmen des Studium generale angesetzt werden, und dividiere die Hörerzahl durch die Gesamtzahl der Studenten. Der dürftige Quotient ist nicht Indikator für mangelhaftes Interesse, sondern Ausdruck einer Überfülle des fachlichen Lehrstoffes. Das Interesse unserer akademischen Jugend an Allgemeinwissen ist mindestens ebenso groß wie früher (nach meinen Erfahrungen wesentlich größer als vor 30 Jahren). Aber es muß auf der höheren Schule befriedigt werden.
Die Universität bietet nicht nur den Lehrplan mit seinen unausschöpfbaren Quellen an, sie ist auch mit bedeutenden Mitteln ausgestattet, um dem Studenten den Universitätsbesuch zu ermöglichen. Es geht hier nicht um die statistische Aufgliederung globaler Unterhaltungskosten nach der Studentenzahl, sondern um die unmittelbare wirtschaftliche Hilfe für den einzelnen, die in Form von Stipendien und Beihilfen verschiedener Art gewährt wird. Daß man hier um ständige Verbesserungen bemüht ist, zeigt der Hessische Staat, der jedem Sohn seines Landes die Bezahlung des Hörergeldes und der Studiengebühren erläßt. Wir sind leicht geneigt, solche sozialen Leistungen als eine Errungenschaft unserer modernen Zeit anzusehen. Das ist nicht berechtigt. Die Gründer unserer alten ehrwürdigen Universitäten haben vor Jahrhunderten für ihre studentische Jugend nicht schlechter gesorgt. Stipendien und Freitische waren damals wohlbekannte und für den Bestand der Universität sehr wichtige Einrichtungen. Bei der Gründung der Gießener Universität (1607) wurden darüber hinaus Höchstpreise für die lebensnotwendigen Güter und amtliche Wohnungstaxen festgesetzt, um die Studenten vor ungerechtfertigten Preissteigerungen zu schützen. Hochmoderne Maßnahmen also aus einer Zeit, die 350 Jahre zurückliegt.
Durch nichts ist die Bestimmung der Universität umfassender und treffender ausgedrückt worden als durch die Bezeichnung „Alma Mater".
Die Gabe verpflichtet
Gaben und Geschenke nimmt man nicht an, ohne eine Verpflichtung einzugehen. Dieser Gedanke läßt sich offenbar auf die Universität unschwer anwenden und ist auch verwirklicht. Wer nach erfolgreichem Studium sein Examen absolviert und sich der Berufspraxis widmet, gibt wahrhaftig seinem Volk zurück, was er von der Alma Mater empfangen hat, als Theologe, Jurist, Ingenieur, Philologe, Mediziner usw., und jeder mag sich zu der Frage berechtigt fühlen, die Wagner an seinen Lehrer Faust richtet:
„Tut nicht ein braver Mann genug, die Kunst, die man ihm übertrug, gewissenhaft und pünktlich auszuüben?"
Das ist es, worum es hier geht: Gewissenhaft und pünktlich. Mit dieser Vorstellung geht der pflichtbewußte Akademiker in die Praxis und unterwirft sich dem Rhythmus, den Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit bestimmen. So wird mit der praktischen Berufsarbeit zurückerstattet, was die Universität gab, aber nicht mehr. Damit ist das statische Gleichgewicht Nehmen-Geben hergestellt. Der reibungslose Ablauf dieses Vorgangs gewährleistet wichtige Funktionen im zivilisierten Leben. Dabei weiß ich nur zu gut, daß Angehörige mancher Berufsgruppen, vor allem der freien Berufe, täglich ein sehr großes Arbeitspensum zu bewältigen haben. Denkt man aber genügend darüber nach, daß die Universität ihren lebendigen Inhalt der Dynamik verdankt, daß sie durch die Relation Nehmen-Rückerstatten nicht gefördert wird, sondern der Erstarrung erliegt? Nicht der Auftrag, das vermittelte Wissen praktisch anzuwenden, fördert ihre Leistung, sondern die Aufgabe, die sie zur eigenen Bereicherung ihren Jüngern stellt und aus deren Lösung sie neue Erkenntnis und neue Impulse für ihre Lehraufgabe gewinnt. Will man also den Begriff „Universität als Aufgabe" schärfer umgrenzen, so umfaßt er die Verpflichtung, der Universität zu dienen, an ihrem Bestand und ihrer Fortentwicklung zu arbeiten mit dem Ziel, Unbekanntes zu erschließen und die Lehre zu bereichern. Wer wagt den Versuch, die Anwartschaft auf diesen Dienerkreis zu erwerben? Wer ist nach erfolgreichem Studienabschluß bereit, sich mit Mut, Energie, Fleiß und Ausdauer zu rüsten, um dieses Ziel anzustreben? In Wort und Schrift wird alle Tage der Mangel an wissenschaftlichem Nachwuchs beklagt. Schenkt unsere akademische Jugend diesem Hinweis die notwendige Beachtung? Begreift sie ihn überhaupt? Oder, was mir viel bedenklicher erscheint, besitzt unser Volk wenigstens in den Kreisen der Akademiker, von denen man es am ehesten erwarten sollte, noch Väter, die den Willen haben, ihre Söhne für diese Aufgabe zu begeistern? Ich möchte hier an meine Kartellbrüder appellieren, sich diese Frage vorzulegen und vor allem zu ihr Stellung zu nehmen. Die Antwort wird, vom Geist unserer Zeit beeinflußt, wohl sicher von wirtschaftlichen Argumenten ausgehen.
Der Hinweis auf die unzureichende wertungwissenschaftlicher Arbeit besteht zu Recht. Man darf seine Überzeugungskraft nicht schmälern. Unsere Universitäten betonen unablässig und mit größtem Ernst die Notwendigkeit, das Maß für die Bewertung wissenschaftlicher Arbeit neu zu eichen; sie fordern mit Recht von den Trägern der Regierungsgewalt mehr Mittel für wissenschaftliche Forschung. Unsere Tageszeitungen nehmen sich der Sorgen unserer Universitäten an und mahnen den Staat und die Länderregierungen unablässig, die Universität zu fördern. Das alles soll hier nicht übersehen und in seiner Bedeutung für unsere Fragestellung nicht unterbewertet werden. Was für unsere Universitäten und für die wissenschaftliche Forschung getan wird, reicht nicht aus. Aber daß für den studentischen Nachwuchs doch vieles geschehen ist, wurde am naheliegenden Beispiel Hessen (Prof. Vossschulte ist Direktor der Chirurg. Klinik an der Justus-Liebig-Hochschule in Gießen. Der Hsg.) erläutert. Ob dieser Weg der Universität die Kräfte zuführt, die sie braucht, um ihre Aufgaben zu erfüllen, ist vorläufig noch unsicher. Auch von einer besseren gehaltlichen Einstufung der wissenschaftlichen Assistenten an unsern Universitäten darf man sich allein keine Wunder versprechen. Mit einem attraktiven Anfangsgehalt, das sicher manchen anlocken mag, ist für die Aufgaben, auf deren Lösung die Universität wartet, nichts geschehen, gar nichts! Was hier den Ansporn geben muß, ist der Wille, einem hohen Ziel zuzustreben, der Wunsch, selbst Mitgestalter der akademischen Provinz zu werden, und — das ist besonders wichtig — die Bereitschaft, der wissenschaftlichen Arbeit mit ganzer Kraft zu dienen. Dazu gehört unermüdliches Schaffen, Energie, Fleiß, Ausdauer und Verzicht auf angenehme — oft könnte man wahrlich sagen tändelhafte, geisttötende, stupide — Freizeitnutzung. Der Weg ist heute noch mehr als früher mühsam! Klingt das nicht geradezu barbarisch? Kann man das heute einem jungen Menschen noch zumuten, wenn er am 1. Mai aus den Lautsprechern die dröhnenden Stimmen hört, die das Heil in Form der 40-Stunden-Woche anpreisen? Ich meine, man kann es, weil jedes Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit mit dem befriedigenden Bewußtsein des eigenen Anteils an der Bereicherung unserer Erkenntnisse reich belohnt wird. Das ist der akademischen Jugend auch nicht gänzlich unbekannt, wie ein Blick auf unsere Universitäten lehrt. Leider stößt man dabei auf eine betrübliche Feststellung. In der Reihe des wissenschaftlichen Nachwuchses sind die KVer nur äußerst dürftig vertreten. Ich sehe sie als schneidige Zuhörer, wenn auf Festkneipen und Kommersen Prinzipienreden gehalten werden. Offenbar ist aber der Inhalt des 2. Prinzips, auf das es uns hier ankommt, am wenigsten begriffen worden, und zwar schon seit Jahrzehnten. Man mag die Zeiten des Kulturkampfes als Entschuldigung benutzen können, um zu erklären, daß es für den Katholiken Zeiten gegeben hat, in denen seine Entfaltung behindert war. Mir will übrigens heute diese Argumentation in einem anderen Licht erscheinen als vor 30 Jahren in der Fuchsenstunde. Diese Zeiten sind auf dem Gebiet der Wissenschaften vorüber.
Die Universität steht seit Jahrzehnten auch jedem KVer zur Mitarbeit offen, wenn er bereit und fähig ist, ihre Aufgaben zu meistern. Die eigenen Erfahrungen zeigen mir, daß es in unseren Reihen vor allem an der Bereitschaft mangelt. Das ist höchst bedauerlich. Einen Vorwurf kann man hier dem Philistertum nicht ersparen. Von ihm würde man erwarten wollen, daß es danach strebt, die Söhne zu höherem Ziele hinzuführen. Das geschieht oft nicht; und den jungen KVern fehlt offenbar der Mut, aus eigenem Antrieb den Einsatz zu wagen. Es fehlt ihnen der Mut, sich mit den Kollegen aus anderen Verbänden oder aus der freien Studentenschaft zu messen. Diese Feststellung ist mir seit Jahren eine Quelle mancher Enttäuschungen. Die Zahl der Kartellbrüder, die mit ehrgeizigem Einsatz eine führende Stellung im akademischen Leben zu erarbeiten bereit sind, müßte größer sein. Sehr kärglich aber ist das Ergebnis, wenn man in den Reihen der Dozenten und Professoren unserer Universitäten nach KVern sucht. Hier haben die Kartellbrüder versagt und versagen auch heute noch. Sie treten zum edlen Wettlauf gar nicht an, weil es ihnen an Begeisterung für eine hohe Aufgabe, an Mut und Bereitschaft zu harter, ausdauernder wissenschaftlicher Arbeit mangelt. Dieser Verzicht ist betrüblicher als die Feststellung des Ergebnisses.
Es ist an der Zeit, daß sich die Aktivitas dieser Frage annimmt. Von unserem Philistertum kann man es kaum erwarten. Aber unsere Jugend im Verband sollte erkennen, daß die Universität nur Alma Mater bleiben kann, wenn sie damit rechnen darf, daß sie Jünger findet, die bereit sind, ihr zu dienen. Hier sollte unsere Kartelljugend in größerer Zahl mit besonderen Leistungen für ein hohes Ziel dokumentieren, daß sie auch harte und mühsame Arbeit im Dienst für die Wissenschaft, die sie auf den Kommersen besingt, nicht scheut. Unser Verband hat die wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, daß dieser Anruf, der von der Universität für die ganze akademische Jugend gedacht ist, auch in den eigenen Reihen besser verstanden wird. Wir sind der Universität unseren Beitrag für Forschung und Lehre schuldig. Die jungen Kartellbrüder mögen antreten, ihn zu leisten und zu beweisen, daß in unseren Korporationen Männer heranwachsen, die den Wunsch haben, sich mit Tüchtigkeit und Fleiß wissenschaftlichen Aufgaben der Universität zu widmen. Auch das Ansehen unseres Kartellverbandes würde dadurch noch sehr wirkungsvoll gefördert werden können.
Literaturhinweise
Becker, Werner:
Junge Kirche an der Universität, Lebendiges Zeugnis, Heft 2 WS 1952/53
Denifle, Heinrich:
Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400, Berlin 1885
Heimpel, Hermann:
Hochschule, Wissenschaft, Wirtschaft, Partner im Fortschritt, V 1955. hsg. v. Stifterverband für die deutsche Wissenschaft
Jaspers, Karl:
Die Idee der Universität, Schr, der Universität Heidelberg, 1946
Kaufmann, G.:
Die Geschichte der deutschen Universitäten, 1888
Luible, Martin:
Die deutschen Universitäten und Hochschulen in: Fuchs und Bursch, ein Handbuch für junge und alte KVer, 2. neubearbeitete Auflage, München 1955
Newman, John Henry:
Abendländische Bildung, Herder, Freiburg 1949
Schnabel, Franz:
Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, I. Bd. S. 204—234; S. 408—457; II. Bd. S. 342 ff; III. Bd. Erfahrungswissenschaften und Technik (unübertreffliche Darstellung des Entstehens der Techn. Hochschulen!)
Spranger, Eduard:
Das Wesen der deutschen Universität in:
Das akademische Deutschland, Berlin 1930, Band 3:
Die deutschen Hochschulen in ihren Beziehungen zur deutschen Gegenwartskultur.
Die Idee der deutschen Universität.
Die Grundschriften aus der Zeit ihrer Neubegründung durch klassischen Idealismus und romantischen Realismus, Hermann Gentner Verlag, Darmstadt 1956
(F. W. Schelling, Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, 1803; J. G. Fichte, Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt, 1807; F. Schleiermacher, Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn, 1808; H. Steffens, über die Idee der Universitäten, 1809; W. v. Humboldt, über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftl. Anstalten in Berlin, 1810)
Die Verantwortung der Universität, Werkbund-Verlag, Würzburg 1954. (Drei Vorträge von: Romano Guardini, Die Verantwortung des Studenten für die Kultur; Walter Dirks, Die Verantwortung des Studenten gegenüber Volk und Staat; Max Horkheimer, Zum Begriff der Verantwortung.)
Zu zeitgemäßen Aufgaben der Universität
Papst Pius XII.
„Universität", bemerkten Wir neulich, „besagt nicht nur Vielfalt von einander fremden Fakultäten, sondern Synthese aller Wissensobjekte ... Und der moderne Fortschritt, die immer mehr vorangetriebene Spezialisierung, verlangen diese Synthese mehr denn je." Allerdings macht sie sie auch schwieriger und gebrechlicher, und die Universität muß sich vor zwei entgegengesetzten Klippen hüten. Die erste bestünde in der unberechtigten Einmischung des Staates, der sich unter Überschreitung seiner Machtbefugnis anmaßte, dem Unterricht aus politischen oder ideologischen Gründen die künstliche Einheit einer willkürlichen Philosophie aufzuzwingen. Umgekehrt jedoch würde die Universität ihre Sendung schlecht erfüllen, wenn sie sich dem Pluralismus oder einem oberflächlichen Synkretismus ergäbe. Rein auf der Ebene der natürlichen Erkenntnisse ist es ihre Aufgabe, über die Verschiedenheit der Disziplinen hinauszuschreiten, eine Weisheit zu fördern und die geistige Persönlichkeit des Studenten zu formen. Sie hüte sich also, in ihrer hohen Sendung zu versagen, die darin besteht, den jungen Geistern die Achtung vor der Wahrheit zu vermitteln und sie zu jenem freien Verhalten zu führen, das für ihre geistige Reife unerläßlich ist.
Papst Pius XII. in einem Brief zum Internationalen Kongreß der PAX ROMANA in Quebec: 12. August 19S2. AAS XLIV (1952) 728—130. Original: französisch. Deutsche Übersetzung A. F. Utz — J. F. Graner in: Soziale Summe Pius XII., Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens, Paulusverlag, Freiburg/Schweiz 1954.
Der demokratische Staat
Franz Meyers
Eine entscheidende Frage
Es gibt für die zukünftige Entwicklung unseres öffentlichen Lebens, für seine politische und moralische Festigung wohl kaum eine Frage, die so brennend wäre wie die nach der Haltung des katholischen Akademikers zum demokratischen Staat. Von seinem Wirken in diesem Staat, von seiner inneren Beziehung zu diesem Staat wird das Werden unserer jungen Demokratie in maßgeblichem Umfange abhängig sein. Er wird über die Formen und Methoden mit zu entscheiden haben, in der diese junge Demokratie im täglichen Leben angewandt und vor der breiten Öffentlichkeit unseres Volkes sichtbar gemacht wird. Und da unser Volk in seiner eigenen Geschichte bis heute noch nicht fähig war, von der Übereinstimmung breitester Volksteile getragene allgemeingültige Formen des demokratischen Lebens sich zu erarbeiten, wird diese wachsende Form einen entscheidenden Einfluß auf den Inhalt, das Wesen und damit die Chance der Demokratie in unserem Lande haben.
Aber nicht nur deshalb ist das Problem der Stellung des katholischen Akademikers zum demokratischen Staat so drängend. Wir haben gerade in der jüngsten Vergangenheit, in den letzten Monaten, in verstärktem Umfange Stimmen vernommen, die geeignet sind, eine echte Beziehung des katholischen Akademikers wie überhaupt der Gesamtheit der Katholiken zum demokratischen Staate zu belasten. Wie bemerkenswert und bedenklich häufig ist in letzter Zeit von Klerikalismus und Konfessionalismus die Rede gewesen, und zwar in jenem verurteilenden und oft verächtlich machenden Sinne, der bewußt oder halb bewußt darauf hinausgeht, unser Volk glauben zu machen, der Katholik und erst recht der durch seine akademische Vorbildung im öffentlichen Leben hervortretende Katholik hätte nicht nur keine Beziehungen zum demokratischen Staat; er sei vielmehr für die Entwicklung des demokratischen Staates geradezu eine Gefahr. Erst einige Zeit ist es her, daß von der Tribüne unseres Parlamentes die Parole aus dem Munde eines Politikers gefallen ist: „Es gibt nur einen Staat, und das ist der liberale Staat." Zeit, Ort und Betonung gaben diesem Ausspruch fast den Charakter eines Fanals und hoben ihn jedenfalls für jeden, der sich ein Gespür für geistig-politische Zusammenhänge bewahrt hat, über die flüchtigen politischen Tagesparolen hinaus. Aber nicht nur daraus, sondern aus vielerlei gleichartigen Worten und Handlungen läßt sich schließen, daß die Auseinandersetzung mit dieser Parole unsere nahe Zukunft wohl stärker als bisher beherrschen wird. Um so mehr ist es an uns, erneut einen klaren Standpunkt zur Frage des Verhältnisses von katholischem Akademiker und demokratischem Staat einzunehmen.
Mit Recht ist das Thema auf das Verhältnis zum demokratischen Staat begrenzt. Es würde gewiß zu weit führen, das Verhältnis des Katholiken zum Staat allgemein in diesem Rahmen zu erörtern. Zudem ist nun —■ daran kann kein Zweifel sein — nach dem Willen der Verfassung des Bundes und seiner Länder die Demokratie unsere verbürgte und verfassungsrechtlich gesicherte Lebensform. Auf das Verhältnis des katholischen Akademikers zu ihr kommt es daher heute in unserem Volke ausschließlich an.
Das Bild des demokratischen Staates von heute
So haben wir uns zunächst zu fragen, wie sich dieser demokratische Staat uns heute darbietet. Dabei fällt gerade dem etwas mit der Geschichte der Demokratie Vertrauten am ersten ins Auge, daß die Demokratie, wie sie sich in der Form unseres Grundgesetzes und der Verfassungen der Bundesländer uns heute darbietet, längst nicht mehr die Demokratie ist, die seit der Französischen Revolution gewissermaßen als das Modellstück eines modernen europäischen demokratischen Staatswesens angesehen wurde und wie sie sich etwa in Deutschland noch im Verfassungswerk von Weimar darbot. Diese neue deutsche Demokratie ist hinausgewachsen aus der alleinigen Grundlage eines fiktiven Gesellschaftsvertrages, eines contrat social, herausgewachsen aus dem formalistischen Dreiklang „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit", herausgewachsen aus einer nur mechanistischen Gewaltentrennung. Vor allem aber ist diese Demokratie hinausgewachsen aus ihren liberalistischen Wurzeln, aus der fatalen Trennung von privater und öffentlicher Moral, aus der antireligiösen, ja oft sogar atheistischen Trennung von Staat und Kirche, die in Wahrheit nichts anderes bedeutete, als die Ausklammerung einer zur Hüterin des Sittengesetzes und der ethischen Grundlagen jedes sozialen Lebens berufenen Instanz aus dem öffentlichen und staatlichen Leben. Und endlich hat diese neue Demokratie gebrochen mit jenem machiavellistischen Staatsegoismus, der sich von jeder sittlichen Bindung frei glaubte und der die im Staat bestehenden, gewachsenen, vorstaatlichen sozialen Ordnungen — Ehe, Familie, Berufsstand, Gemeinde und Landschaft — nur noch als eine Schablone ohne inneren Eigenwert und inneres Eigenrecht betrachtete.
Die Krise des 20. Jahrhunderts, die keinen Bereich unseres Lebens verschont hat, hat mit erschreckender Deutlichkeit für den Bereich des öffentlichen Lebens dargetan, daß diese alte Demokratie tot ist. Ihr Erbe ist traurig genug. Sie hat, da sie es nicht verstanden hat, ein echtes Verhältnis zwischen Einzelmensch und Staat zu finden, das Individuum schier hoffnungslos in die tödliche Umklammerung des Massenstaates gegeben. Ihre Verständnislosigkeit für die ethischen Grundlagen jedes menschlichen Zusammenlebens auch im Staate hat in der Praxis unseres politischen Lebens eine erschreckende Nivellierung moralischer Vorstellungen hinterlassen. An ihrer Stelle ist die Ethik des Mehrheitsbeschlusses, das Argument der 51% getreten. Indem sie so das innere Gefüge zwischen Bürger und Demokratie sprengte, höhlte sie den Staat innerlich aus und machte ihn reif für die Entartungen unserer jüngsten politischen Vergangenheit, für Totalitarismus und Faschismus. Aus der „Liberte" wurde schrankenloser Gruppenegoismus, die „Egalite" führte zur Verneinung jedes Persönlichkeitsstrebens, zur Vermassung und zur Herrschaft der Mittelmäßigkeit, und die „Fraternite" endete in der staatspolitischen Vereinsamung des Bürgers.
Zwischen ihn und den Staat schoben sich alle möglichen „Mittler", die als Interessengruppen - pressure-groups — wie die Angelsachsen sie so bezeichnend nennen — ihre Sonderinteressen durchzusetzen versuchen. Vor allem aber verschob sich das Verhältnis von Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung, das rein formalistisch als eine Art Atomzertrümmerung der politischen Macht gedacht worden war, sowohl zur Seite der Gesetzgebung hin, wie wir es heute etwa in den Volksdemokratien sehen, wie zur Seite der Verwaltung hin, wie wir es im totalitären Polizeistaat erlebt haben.
Konnte es wundernehmen, daß der Bürger, außerstande, in diesem zähen Geflecht seine eigene staatliche Mitbestimmung zu verwirklichen, sich zurückzog? Und wie recht schien diese Entwicklung den antiken Denkern zu geben, die der Demokratie nur die beiden Chancen gaben, entweder in der Tyrannei zu ersticken oder aber in der Ochlokratie -— der Herrschaft der Haufen und Gruppen — zu verwildern.
So zeigt sich uns an Hand der geschichtlichen Entwicklung des modernen demokratischen Staatsbegriffes mit schonungsloser Klarheit, daß auch ein sogenanntes modernes Staatswesen der moralischen Grundlagen in Natur- und Sittengesetz nicht entraten kann. Diese Erkenntnis weist aber gleichzeitig den Weg, den die Demokratie gehen muß, und — das dürfen wir heute mit berechtigter Genugtuung sagen — nicht nur bei uns, sondern überhaupt in den westlichen, der abendländischen Kultur verbundenen Staaten gegangen ist, um zu einer neuen und echten sozialen Ordnungsfunktion zu werden. Aus der Demokratie der Wertneutralität und des moralischen Agnostizismus ist die werthafte Demokratie geworden, die aufgebaut ist auf den Grundsätzen des Natur- und Sittengesetzes, des Rechtsstaates, der Menschenrechte und des Föderalismus.
Wie groß die Verschiebung oder besser Korrektur des Verhältnisses von Mensch und Staat in dieser neuen Demokratie im Verhältnis von Mensch zu Staat geworden ist, zeigt in allen neuen Verfassungen, vor allem aber auch in unserem Grundgesetz, jener breite Raum, der der Festlegung und Sicherung der Menschenrechte gewidmet ist. Der Staat bekennt sich zu ihnen „als unverletzlichen und unveräußerlichen Grundlagen der menschlichen Gemeinschaft". Er bestätigt die unantastbare Würde des Menschen. Und er sichert diese Menschenwürde und diese Menschenrechte dadurch, daß er sie im Gegensatz zu früher davon befreit, nicht mehr zu sein als hohle Dekorationsstücke einer Verfassungsurkunde. Sie sind vielmehr unmittelbar geltendes Recht. Sie binden und verpflichten jeden einzelnen Akt der Gesetzgebung, der Verwaltung und der Rechtsprechung. Und wenn sie im Interesse des Gemeinwohls für einschränkbar erklärt worden sind, dann ist dafür Vorsorge getroffen, daß diese Einschränkung niemals für einzelne Personen oder Gruppen vorgenommen, und daß vor allem das Wesen dieses Grund- und Menschenrechtes nicht angetastet werden darf.
Die Grundlegung des Staates als Rechtsstaat besagt, daß alle staatliche Gewalt gebunden ist, nicht nur an das positive gesetzte Recht, sondern auch an das Naturrecht als die Gemeinschaft aller der Rechtsnormen, die ihrem Wesen nach vorstaatlich und überstaatlich sind, und damit durch die Gesetzgebung des Staates nicht angetastet werden dürfen.
Endlich ist es aber das Prinzip des Föderalismus oder der Subsidiarität, das die neue Demokratie dazu befähigt, sich organisch zu gliedern. Jede soziale Funktion soll von dem Glied des Sozialkörpers wahrgenommen werden, das nach Art und Leistungsfähigkeit sowie unter Berücksichtigung des Gemeinwohles diese Funktion selbst übernehmen kann. Das bedeutet nicht nur, daß die Demokratie davor bewahrt wird, von einer Stelle —- und dann allzuleicht autoritativ — gelenkt zu werden und damit zu einer sozialen Wüste zu erstarren, die ein organisches Verhältnis der kleineren sozialen Gemeinschaften letztlich tötet. Es bedeutet vielmehr und vor allem auch, daß damit eine möglichst große Zahl von Bürgern mit echten und eigenverantwortlichen Funktionen ausgestattet und als tätiges Glied der sozialen Gemeinschaft anerkannt wird.
Aber auch diese innere und äußere Neuformung des demokratischen Staates, seine Bindung an jene ethischen und sozialen Grundlagen der Staatsgemeinschaft, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Demokratie eine Form ist, eine Hülle, die mit Inhalt, mit echtem und pulsierendem Leben erfüllt werden muß. Dafür ist aber nicht wie bei der Monarchie oder Aristokratie eine kleine Gruppe oder gar nur einer verantwortlich. Diese Verantwortung trifft vielmehr die Gesamtheit des Volkes. So bleibt denn die Demokratie eine gefährdete Staatsform, eine Staatsform, die ständig davon bedroht ist, der inneren Zersetzung und Auflösung zu verfallen, wie es wohl einmalig und für alle Zeiten Piaton in seinem Dialog über den Staat in dem unsterblichen Gleichnis vom Steuermann dargestellt hat, an Hand dessen er die Demokratie so geringschätzig als eine „angenehme, herrscherlose und buntscheckige Staatsform" bezeichnete. Und mahnend ersteht vor uns das Wort des großen Aristoteles, daß die Demokratie zwar in der Theorie die beste, aber in der Praxis die schlechteste Staatsform sei, da sie auf einer utopischen Vorstellung des Menschen aufbaue und damit seine Kraft zur politischen Synthese überfordere.
Katholische Kirche und demokratische Staatsform
So ist die Frage berechtigt, was denn die katholische Kirche als die für uns Katholiken allein maßgebliche Instanz für die Grundfragen unseres menschlichen und sozialen Lebens zu einer solch gefährdeten und trotz aller verfassungstheoretischen Kautelen immer wieder bedrohten Staatsform zu sagen hat, insbesondere aber, ob sie eine solche Staatsform als die für die Erreichung des jedem Menschen in seinem Erdenleben gesetzten Zieles beste Staatsform betrachte. Denn die ungeheure Bedeutung des menschlichen Erdenlebens für sein ewiges Heil macht die Frage begreiflicherweise besonders drängend, ob eine solche Staatsform dieses Ziel des Christen nicht in ihre eigene Gefährdung hineinzieht.
Ich glaube, mich im Rahmen dieser Betrachtungen nicht im einzelnen einer Widerlegung der auch heute noch gelegentlich zu hörenden Vorwürfe zuwenden zu müssen, das Christentum habe überhaupt keine Beziehung zum Staat und jenes bekannte Wort Christi, gesprochen im Blick auf den ihm vorgelegten Steuergroschen, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers sei, und Gott, was Gottes ist, beweise nur die Gleichgültigkeit christlicher Einstellung zum Staat. Diese und die vielen anderen Argumente, die aus den petrinischen oder paulini-schen Briefen immer wieder herausgezogen worden sind, oder gar Rosenbergs unsinnige Theorie, Paulus sei nichts anderes gewesen als der große Revolutionär und Prediger gegen jede staatliche Obrigkeit, sind so oft von Kennern widerlegt worden, daß ich mich hier auf deren Zeugenschaft beziehen darf. Allerdings soll dabei doch an dieser Stelle darauf verwiesen werden, daß nur der einer solchen Verkennung des echten Verhältnisses von Christentum und Staat fähig ist, der im Staat das höchste und wichtigste Ziel menschlichen Strebens sieht. Unter einem solchen Blickwinkel mag freilich das, was Christus über den Staat gesagt hat, wenig erscheinen. Aber dieser Blickwinkel ist eben aus christlicher Sicht völlig falsch und bildet einen der wesentlichsten und grundsätzlichsten Unterscheidungspunkte zu allen säkularisierten Staatsvorstellungen. Für das Christentum ist der Staat zwar eine bedeutungsvolle soziale Einrichtung und besitzt zur Erfüllung der ihm zufallenden Aufgaben Anspruch auf Autorität. Er ist aber keineswegs ein absoluter Wert oder gar das höchste menschliche Ziel. So erschließt sich christliche Staatsauffassung auch nur dem, der bereit ist, die Dinge, von dieser Erkenntnis ausgehend, zu betrachten.
Gilt diese Beschränkung des Staates schon allgemein, so folgt sie natürlich erst recht für die Beurteilung der einzelnen Staatsformen. Hier wäre es noch bedenklicher, ja verhängnisvoller, würde die Kirche sich auf die einseitige Billigung oder gar Propagierung einer Staatsform einlassen. Nicht nur, weil die berühmten sogenannten klassischen Staatsformen — Monarchie, Aristokratie, Demokratie — im Laufe der geschichtlichen Entwicklung fast niemals rein und ungemischt vorgekommen sind, sondern weil jede Staatsform gesehen werden will auf die allgemeinen geschichtlichen Gegebenheiten ihrer Zeit hin. So hat denn die Kirche sich im Laufe der geschichtlichen Entwicklung niemals mit einer bestimmten Staatsform identifiziert. Was aber speziell die demokratische Staatsform angeht, so hat schon Leo XIII. in einer Zeit, als der moderne parlamentarisch-demokratische Staat seinen Siegeszug durch Europa antrat, in der Enzyklika „Libertas" ausdrücklich festgestellt, daß es nach der Lehre der Kirche „nicht verboten ist, Regierungsformen den Vorzug zu geben, die durch die Mitwirkung des Volkes beeinflußt werden; denn die Kirche lehnt keine der vielen verschiedenen Formen ab, die eine Regierung haben kann, sofern sie nur geeignet ist, das Wohl des Bürgers zu sichern".
Aber auch aus dem Munde des regierenden Papstes haben wir unmißverständliche Zeugnisse dafür, daß er den demokratischen Staat an sich anerkennt. Hat er sich doch in seiner Weihnachtsbotschaft vom Jahre 1944 über Demokratie und Weltfrieden eingehend mit dem Problem der Demokratie, des Bürgers und der Regierung im demokratischen Staat und den Voraussetzungen befaßt, unter denen ein demokratischer Staat christlichen Grundsätzen entspricht. Ausgehend von der wachsenden Müdigkeit der Völker, den Katastrophen des Staatsabsolutismus und den bitteren Erfahrungen totaler Kriege kommt der Papst zu dem Ergebnis: „Die Welt wäre nicht in diesen vernichtenden Wirbel des Krieges hineingezogen worden, wenn es möglich gewesen wäre, das Vorgehen der öffentlichen Macht zu kontrollieren und zu steuern." Sodann stellt der Papst einige Wesenszüge einer echten Demokratie auf. „Seine Meinung sagen über die ihm auferlegten Pflichten und nicht gezwungen sein zu gehorchen, ohne gehört worden zu sein", sind typische Rechte einer Demokratie. Ihr Ziel muß weiter darauf gerichtet sein, das Volk organisch mit dem Staat zu verbinden. „Die Masse ist der Hauptfeind der Demokratie und ihres Ideals von Freiheit und Gleichheit." Des weiteren muß ein wahrer demokratischer Staat mit „einer Befehlsgewalt ausgerüstet sein, die auf wahrer und wirksamer Autorität beruht". Vor allem muß auch eine innige Verbindung zwischen Mensch, Staat und öffentlicher Macht bestehen. Endlich aber ist es erforderlich, daß in den Körperschaften des demokratischen Staates und in seiner Regierung nur solche Männer tätig sind, deren charakterliche und geistige Kräfte, deren sicheres Urteil, praktischer Sinn und Arbeitseifer sie als Elite ihres Volkes darstellen, die dafür sorgen, daß die Ordnung des Staates stets gemessen wird an Natur- und Sittengesetz, daß die Staatsmacht aus dem Prinzip der Subsidiarität so auf alle sozialen Gruppen verteilt wird, daß ein echtes harmonisches Miteinander entsteht. Als höchstes Gut haben sie aber nicht nur für Frieden und Wohlfahrt in ihrem eigenen Volke zu wirken, sondern gleichzeitig den Gedanken der Bruderschaft aller Völker zu pflegen und nach seiner Verwirklichung zu streben.
Betrachten wir so die Forderungen des Christentums an dem demokratischen Staat, so darf wohl mit Recht gesagt werden, daß die heutige staatliche Ordnung in unserem Volke zumindest die Möglichkeit der Verwirklichung solcher Forderungen gewährleistet, weil echte Demokratie und christlicher Glaube gerade dort ihre engsten Berührungspunkte haben, wo sie beide um die Persönlichkeitsentfaltung des Menschen ringen, um seine Freiheit und seine Würde, und dort engste und untrennbare Beziehungen zueinander haben. Gilt doch für den echten demokratischen Staat das Wort des englischen Philosophen John Stuart Mill: „Ein Staat, der die Menschen verkleinert, um sie zu gefügigeren Werkzeugen in seinen Händen zu machen, und sei es auch um nützlicher Zwecke willen, wird erfahren, daß mit kleinen Menschen keine große Sache wirklich vollendet werden kann." Und für das Christentum hat kein Geringerer als der zeitgenössische französische Denker Jacques Maritain in seiner Schrift „Christentum und Demokratie" nachgewiesen, daß der demokratische Lebenstrieb in der Menschheitsgeschichte als weltliche Ausdrucksform des Christentums emporgewachsen ist.
Zu politischer Mitverantwortung verpflichtet
So kann denn kein Zweifel bestehen, daß der Katholik und insbesondere der katholische Akademiker die Verpflichtung hat, sich mit all seinen Kräften dafür einzusetzen, daß die Form des modernen demokratischen Staates mit christlichem Geist erfüllt wird.
Fragen wir uns nun, wie es damit steht, so sollten wir vor allem nicht vergessen, daß gerade die Akademikerschaft und die Intelligenz auf diesem Gebiete eine schwere Schuld trägt. Der Philosoph Peter Wust hat dies einmal in die Worte gefaßt: „Die Schuld für die verzweifelte Situation, vor der wir heute stehen, fällt mit ihrem ganzen Schwergewicht auf die Schultern der europäischen Intelligenz." Waren es nicht europäische und auch deutsche Akademiker, die die philosophischen Grundlagen für die soziale Verwirrung und politische Verwilderung der Demokratie gelegt haben? Haben nicht die Rousseau und Comte, die Hegel und Feuerbach, die Haeckel, Marx und Nietzsche, und wie sie alle heißen mögen, jenes Chaos, vielleicht ungewollt, durch ihre Gedanken mit vorbereitet, in das unser Volk, Europa und die Welt hundert Jahre später gestürzt wurden? Wer wollte sich anmaßen, angesichts dieses Chaos noch zu behaupten, daß das Wirken auf den Lehrstühlen und Kathedern am wirklichen, sozialen und politischen Leben spurlos vorbeiginge? So haben wir alle denn heute die Verpflichtung, uns mit ganzer Kraft dafür einzusetzen, daß das Gehäuse der demokratischen Staatsform in unserem Volke nicht wieder von solchen Gefahren übermannt wird. Gewiß, ich würde die Unwahrheit sagen, würde ich nicht gerne, bereitwillig und dankbar zugestehen, daß allerorten in unserem Volke sich katholische Akademiker, oft unter schwersten Verhältnissen und Hintanstellung eigener Wünsche und Chancen, darum mühen, die Praxis unseres demokratischen Gemeinwesens aus dem Geiste ihrer Glaubensüberzeugung mitzugestalten und zu formen. Es wäre gleichfalls unrichtig, wenn ich nicht zugestehen würde, daß gerade in den letzten Jahren sich der Einfluß christlicher Überzeugung auf die Praxis unseres öffentlichen Lebens erfreulich verstärkt hat. Aber dennoch wird niemand bestreiten können, daß auch heute noch gerade unter der katholischen Akademikerschaft sich viele befinden, die zu einer Übernahme persönlicher Verantwortung und Mitarbeit nur schwer zu bewegen sind. Bei vielen von ihnen mag die Abneigung gegen jene Form liberalistischer Demokratie der Grund dafür sein, unter der ihnen die Praxis der Demokratie in früherer Zeit begegnet ist. Manche glauben auch, daß sich die früher beklagten Entartungsformen der Demokratie auch heute bereits wieder so sehr bemerkbar machen, daß es zwecklos sei, sich dieser Entwicklung entgegenzu-stemmen und um die Verwirklichung jener Ziele zu ringen, die uns allen bei der Erfüllung des demokratischen Staatsgedankens mit christlichem Geiste vorschweben. Aber leider gibt es auch heute noch unter uns katholische Akademiker, die aus persönlichen, ja oft eigensüchtigen und Bequemlichkeitsgründen die Auseinandersetzung um die Verwirklichung dieser Ziele in der Öffentlichkeit scheuen. Mit letzteren ist eine Auseinandersetzung über die Sache nicht möglich. Hier kann nur der Anruf an das Gewissen eine Besinnung herbeiführen. Diejenigen aber, die gegen einen solchen persönlichen Einsatz aus sachlichen Gründen Bedenken haben, wie ich sie vorher kurz streifte, sollten sich daran erinnern, daß überall im Lande ihre Freunde, oft in zähen Kämpfen, Erfolge errungen haben, die nicht nur Zeugnis ablegen für die Unerschrockenheit und überzeugungstreue, sondern die gleichzeitig jeden ermutigen können, der ob der Schwierigkeiten, der möglichen Anfeindungen und Mißhelligkeiten abseits bleiben möchte.
Vor allem aber sollten wir nie vergessen, daß der aus unserem Glauben entspringende Auftrag für die Gestaltung der Welt uns gerade im demokratischen Staat zu besonderer Kraftanstrengung zwingt. Gilt es doch hier, in formaler Gleichberechtigung mit allen Gruppen und Überzeugungen einen edlen Wettstreit zu führen, um die Verwirklichung der eigenen Ideale. Von unserem Wirken wird die Gestalt der Demokratie von morgen abhängen, um die Sicherung des Erreichten und die Gewähr für das, was an Wünschen bis heute nicht durchzusetzen war. Endlich sollten uns aber jene Rufe nach dem liberalen Staat in einem ganz bestimmten Sinne, von denen ich zu Beginn sprach, davon überzeugen, daß die Auseinandersetzung um den geistigen Inhalt der Demokratie in unserer Zeit weitergehen wird, daß aber vor allem die Bedrohung der Demokratie als politischer Lebensform von den Kräften des Totalitarismus immer noch nicht als überwunden angesehen werden kann.
So sollten wir alle nicht zögern, in dieser Auseinandersetzung mit den Kräften unserer Zeit aus der Kraft unserer Überzeugung mit Hand anzulegen. Mahnung und Anruf, Bestätigung unseres eigenen Schicksals und unseres Wollens sei uns das Wort des Dichters:
Die rohe Macht entfällt den toten Fäusten;
Euch locke es, Beständiges zu leisten!
Literaturhinweise
Herders Sozial-Katechismus
Ein Werkbuch der katholischen Sozial-Ethik in Frage und Antwort, bearbeitet von P. Eberhard Welty O. P.;
in 4 Hauptteilen:
I. Grundfragen und Grundkräfte des sozialen Lebens
II. Aufbau der Gemeinschaftsordnung
III. Ordnung des gesellschaftlichen Lebens
IV. Kirche und natürliche Gemeinschaftsordnung Verlag Herder, Freiburg i. Br., 1953
Sacher, Hermann, u. Nell-Breuning, Oswald von, S. J.:
Wörterbuch der Politik
Gesellschaftslehre
Staatslehre
Zur sozialen Frage
Wirtschaftsordnung
Gesellschaftliche Ordnungssysteme
Verlag Herder, Freiburg/Brsg.
Buchheim, Karl:
Geschichte der christlichen Parteien in Deutschland, Kösel-Verlag, München, 1953
Kaiser, Joseph H.:
Die Repräsentation organisierter Interessen, Verlag Duncker & Humblot, Berlin, 1956
Maritain, Jacques:
Christentum und Demokratie, (übersetzt von Franz Schmal), Augsburg, 1949
Messner, Johannes:
Das Naturrecht, Tyrolia-Verlag, Innsbruck - Wien - München
Messner, Johannes:
Kulturethik mit Grundlegung durch Prinzipienethik und Persönlichkeitsethik, Tyrolia-Verlag, Innsbruck - Wien - München 1954
von der Heydte-Sacherl:
Soziologie der deutschen Parteien, Isar-Verlag, München, 1955
Lord Pakenham:
Christsein im Staate
J. Pinsk:
Ansprüche des Christen an den Staat
Frhr. v. d. Heydte:
Aufbau der europäischen Gemeinschaft in „Lebendiges Zeugnis" Heft 2, SS 1955
Die Kirche als Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft
Michael Schmaus
Die menschliche Gemeinschaft ist heute in mannigfacher und tiefgehender Weise bedroht. Die Gründe hierfür kann man alle auf einen einzigen zurückzuführen: Letztlich liegt die Gefahr in dem Zerfall des Menschenbildes. Der Mensch hat verloren und verliert immer mehr sein eigenes Maß. Er weiß nicht mehr, was er ist. Der Selbstverlust des Menschen bewegt sich in zwei Richtungen. Auf der einen Seite wird er eingeschätzt und behandelt wie eine Sache, wie eine Ware, wie eine Arbeitskraft, auf der anderen benimmt er sich wie ein Gott. Die Mitte findet er nicht. Im Grunde genommen hängen die beiden Entartungen eng miteinander zusammen. Denn der Mensch, der nur als Sache verstanden wird, wird diktatorisch in den Arbeitsprozeß eingefügt. Er wird bewirtschaftet wie andere Objekte des ökonomischen Bereiches. Da öffnen sich den großen und den kleinen Diktatoren viele Chancen für ihre Unterdrückungen und Verknechtungen im Staate, in den Parteien, in den Wirtschaftsgruppen, in den Berufsgruppen, in den Familien.
Die Kirche schützt in dieser beinahe verzweifelten Situation den Menschen in seinem wahren Sein und Sinn, und zwar durch zwei Methoden, dadurch, daß sie das wahre Menschenbild proklamiert, und dadurch, daß sie den menschenwürdigen Vollzug des Lebens ermöglicht und verbürgt. Indem sie in dieser zweifachen Weise den Menschen vor den Gefahren rettet, die von ihm selbst kommen, leistet sie den entscheidenden Beitrag für die sinnvolle Ordnung der menschlichen Gemeinschaft. Nur dort, wo der Mensch als das verstanden wird, was er ist, kann das rechte Verhältnis des einen zum anderen, des einzelnen zur Gemeinschaft und der Gemeinschaft zum einzelnen erkannt und realisiert werden.
Künderin des wahren Menschenbildes
Welche Botschaft hat die Kirche vom Menschen? Sie bezeugt, daß er einen hohen Rang hat. Daß der einzelne so sehr über allen Sachen steht, daß der innerste Kern des Menschen, sein Gewissen, nichts und niemandem geopfert werden darf. Der Rang des Menschen hat darin seinen Grund, daß er die Erscheinung Gottes in der Welt, der Sohn Gottes und daß er Bruder des in die Geschichte eingegangenen ewigen und einzigen Gottessohnes ist. Am Menschen zeigt sich immer mehr als bloß Menschliches; denn an ihm wird Gott selbst sichtbar in Verhüllungen, die oft intensivster Art sind, aber dennoch real. Die Gottbildlichkeit des Menschen wirkt sich nach dem Zeugnis der Kirche bzw. nach dem Zeugnis der von der Kirche verbürgten und ausgelegten Heiligen Schrift aus in der Freiheit des Menschen. Der Mensch ist frei, ja er ist ein Herr in der Teilnahme an Gottes Souveränität (Gen. 1, 26—28). Die Freiheit, in welcher die Kirche die Größe des Menschen erkennt, umfaßt drei Bereiche, wir können auch sagen: sie erhebt sich in drei Stufen. Da ist von außen nach innen gesehen die politische und wirtschaftliche Freiheit mit ihren zahlreichen Variationen, die psychologische Freiheit (die Freiheit des Wählens, der Entscheidung) und die geistliche Freiheit (die Freiheit von der Versklavung an das Böse, an den Haß, an die Lüge, an die Eitelkeit usw.). Die drei Stufen sind so eng miteinander verbunden, daß jede die Voraussetzung oder die Auswirkung der anderen ist. So ist die Wahlfreiheit die Bedingung für die politische und die wirtschaftliche Freiheit. Die letztere könnte es ohne die erste nicht geben. Sie stirbt denn auch, wenn die Menschen die Entscheidungsfreiheit mit der sie begleitenden Verantwortung hassen. Jeder Zusammenbruch im politischen Freiheitsraum setzt einen Zusammenbruch im psychologischen Freiheitsraum voraus. Die politische und die wirtschaftliche Freiheit hätte auch gar keinen Sinn, wenn es nicht die psychologische gäbe oder wenn diese nicht mehr geübt würde. Die geistliche Freiheit ist Bedingung und Voraussetzung eines sinnvollen Vollzugs der psychologischen Freiheit, denn das freie Handeln des Menschen hat seinen Sinn nicht in dem Vollzug des Aktes selbst, sondern in der Verwirklichung des Richtigen. Damit aber der Mensch das Richtige, welches das Gute und das Wahre ist, verwirklichen kann, muß er frei sein von jenen Fesseln, die ihn daran hindern. Das ist die Verfallenheit an das eigene Ich bzw. die Verliebtheit in das Ich, in welcher der Mensch nur um sich kreist und sich nicht dem Wahren und Guten zuwendet, um dessentwillen allein die Wahlfreiheit in Gang gesetzt werden darf.
Die Kirche verhilft dem Menschen zu der geistlichen Freiheit, der Grundlage und zugleich der Krönung der beiden anderen Freiheiten, indem sie ihm durch ihre Verkündigung das Auge öffnet für seine eigene Befangenheit, nämlich für seine Fesselung durch die Sünde und zugleich für das Wahre und Gute, welches verwirklicht werden muß, wenn sich der Sinn der Freiheit erfüllen soll. Das Wahre und Gute wird verwirklicht in der Zuwendung zu der Welt der Dinge, zu der Wirklichkeit des Menschen und zu Gott. Der Mensch kann also seine Wahlfreiheit nur dann sinngemäß realisieren, wenn er sich an die Dingwelt und an die Personalwirklichkeit, welche letztlich das Du Gottes ist, bindet.
Indem die Kirche die Freiheit des Menschen in Bindung verkündet, unterscheidet sie sich sowohl von der Freiheitsproklamation des Liberalismus als auch von der Freiheitzerstörung des Bolschewismus. Indem der erstere die bindungslose Freiheit verkündete, gab er jener Entwicklung Antrieb und Rechtfertigung, in welcher das vorige Jahrhundert die Feindschaft zwischen Kapitalisten und Arbeitern hervorbrachte. In dem Versuch der Industriearbeiter, sich die Freiheit aus der Verknechtung zu erringen, bildete sich jener Kollektivismus, welcher der dialektische Gegenschlag gegen den Liberalismus ist und in Wahrheit zur vollen Unfreiheit führte. Die Kirche verkündet gegenüber beiden freiheitsfeindlichen Systemen jene Freiheit, die dem Menschen gemäß ist. Es ist die Freiheit, in der sich der Mensch in freier Entscheidung bindet an die Wirklichkeit, der er zugeordnet ist, ohne die er daher sein Leben nicht sinngemäß und menschenwürdig zu vollziehen vermag. So wird die Freiheit, die sich nicht vollzieht in der Hingabe an Gott, für den Menschen zur Hölle, da er in dem Widerstand gegen Gott Widerstand gegen sich selbst, das Bild Gottes, leistet, und den Widerspruch und die Zerrissenheit in sich selbst hineinträgt. Diese bricht immer wieder aus in Gewalt und Grausamkeit gegen die Mitmenschen.
Indem die Kirche die Freiheit des Menschen verkündet, verpflichtet sie die Menschen zur Freiheit, denn ihre Verkündigung ist nicht nur eine Unterrichtung über das wahre Menschenbild, sondern ein Appell, als Mensch und nicht als Sache und nicht als Tyrann zu leben. Die Kirche verpflichtet den Menschen darauf, als Bild Gottes seine Existenz immer wieder von neuem zu realisieren.
An der kirchlichen Freiheitsproklamation wird deutlich, daß die menschengemäße und menschenwürdige Freiheit zur Gemeinschaft nicht in Widerspruch steht, sondern sich gerade in ihr verwirklicht. Die Gemeinschaft ist der lebendige Raum, in welchem allein die Freiheit sinnvoll gedeihen kann. Freiheit bedeutet nicht Isolierung und Absonderung, sondern die Fähigkeit zur Hinwendung. Je intensiver der Mensch die Freiheit vollzieht, um so intensiver wendet er sich dem Du, bzw. der Gemeinschaft zu. Umgekehrt, je intensiver der Mensch gemeinschaftsverbunden sein will, um so mehr muß er sich in seinem Freiheitsvollzug anstrengen.
Kraftquell freien Dienstes
Die zweite Form, in welcher die Kirche dem Gemeinschaftsleben dient, liegt im sakramentalen Bereich. Hierüber soll nur ein kurzes Wort gesagt werden. In den Sakramenten verhilft die Kirche dem Menschen zur Befreiung von den freiheitshemmenden Kräften, von denen vorher die Rede war. In jedem Sakrament in anderer Weise. So wird z. B. der Mensch in der Taufe und in der Firmung von jener Verlorenheit an die Dinge und an sich selbst befreit, welche eine wahre Hingabe nicht entstehen läßt. Er wird auch von der Angst befreit, welche ihn hindert, das Gute und das Wahre in einer lügenhaften, genußsüchtigen und zynischen Umgebung zu leisten. Die ihn also davon zurückhält, ein Mann zu sein, der den Mut der Entscheidung und der Verantwortung besitzt. In diesen beiden Sakramenten wird der Mensch geradezu für diese Freiheitsfähigkeit gesalbt. Die Salbungen, die hier vorgenommen werden, sind Abkömmlinge jener alt-testamentlichen Salbungen, welche den Königen zuteil wurden. In der Taufe und in der Firmung (ebenso natürlich in den sonstigen Sakramenten, in denen eine Salbung vorkommt) wird der Mensch zum König gesalbt.
Am meisten trägt die Kirche für die wahre Ordnung der menschlichen Gesellschaft in der Eucharistiefeier bei. In ihr gehen die Teilnehmer immer wieder von neuem, in stets wiederholtem Anlauf in jene Liebe ein, in der sich Christus bis zur äußersten Möglichkeit opferte. Sie werden so einerseits frei von der Selbstsucht, in der sich die Menschen gegeneinander abschließen, und empfangen anderseits Impulse für die Hingabe und den Dienst an der Gemeinschaft. Die um den gleichen eucharistischen Opfertisch versammelt sind, werden darin Brüder, die tiefer als durch die Bande des Blutes, nämlich durch die Kraft des Gottesgeistes selbst miteinander verbunden sind. Diejenigen, die in der Feier des Mysteriums Brüder sind, können, wenn sie nicht zu sich selbst in Widerspruch geraten wollen, nicht aufhören, Brüder zu sein im Alltag; ja, ihre brüderliche Gesinnung wirkt hinein in das ganze öffentliche, in das politische und ökonomische Leben. Sie bewegen sich in ihm zugleich als freie, ihrer Verantwortung bewußte Kinder Gottes und als Verpflichtete und Beauftragte irdischen Dienstes.
Sowohl aus der Verkündigung und Proklamation der menschlichen Freiheit, als auch aus der ständigen Befreiung des Menschen zur wahren Freiheit in der Liturgie erhebt sich ein Zeichen, um welches sich alle kirchlichen Hoffnungen und Bemühungen bewegen, nämlich das Zeichen des Kreuzes. Indem der Mensch seine Selbstsucht an das Kreuz schlägt, indem er sich also im Glauben an den gekreuzigten Christus bindet, gewinnt er seine eigene Freiheit und zugleich die mit ihr gegebene Dienstfähigkeit gegenüber der Welt, der menschlichen Gemeinschaft und Gott. Der Mensch hat zuletzt innerhalb der Geschichte nur die Wahl, sich selbst oder andere zu kreuzigen. Wer den Mut zur Selbstkreuzigung aufbringt, gewinnt die Freiheit. Der andere bleibt ein Sklave, auch wenn er sich zum Tyrannen emporschwingt.
Literaturhinweis
Heribert Schauf, Die Kirche als Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft in „Lebendiges Zeugnis" Heft 1 WS 1956/57 Weitere Literatur ist angegeben im Anschluß an die Ausführungen über die Prinzipien des KV auf Seite 93 f.
Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer
(Sx, Bsg, Arm, E d. Ask, E d. Gst)
Ein Jahrhundert ist nun vergangen, seitdem katholische Studierende sich an deutschen Universitäten zu Korporationen zusammenschlössen, aus denen bald danach unser Verband hervorgegangen ist. Die Geistesgeschichte des deutschen Katholizismus dieses letzten Jahrhunderts ist ohne die Geschichte des katholischen Korporations-Studententums undenkbar. Mit Freude und Stolz gedenken wir in diesen Tagen der ungewöhnlich großen Zahl bedeutender Männer, die aus unserem Verband hervorgegangen sind und in Kirche und Staat, in Wissenschaft und Kultur sich einen geachteten Namen gemacht haben. Möge unser Verband auch in Zukunft seine Pflicht gegenüber Kirche, Volk und Staat erfüllen! Grußwort an die Vertreterversammlung 1953 „100 Jahre KV-Studententum"
Akademikertum verpflichtet
Forderungen der Zeit
Walter Hailer
Der Akademiker muß sich als ein verantwortungsbewußter und gleichberechtigter Teil der Gemeinschaft unseres Volkes betrachten. Er darf sich weder absondern noch isolieren lassen. Das alles bedeutet aber nicht Anbiederung oder Verzicht auf eigene Lebensformen und gesellschaftliche Bindungen. Dieses Recht, das auch jeder andere für sich in Anspruch nimmt, steht dem Akademiker als freiem Bürger in gleichem Maße zu. Was er aber peinlichst vermeiden sollte, ist der Eindruck einer überheblichen Exclusivität. Nichts erzeugt in unseren Tagen mehr; Mißtrauen und feindselige Einstellung als Überheblichkeit. Den sichersten Weg, in breitesten Schichten das klassenmäßige Denken und das Vorurteil gegenüber dem Akademiker abzubauen, um damit die Ursachen für eine akademikerfeindliche Einstellung zu beseitigen und dem Akademiker auch für die Zukunft die gerechte Einwertung und Anerkennung seitens der Nichtakademiker zusichern, sehe ich darin, daß die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß jedem für ein akademisches Studium hervorragend Begabten — gleich aus welchen Kreisen er stammt — der Weg zur akademischen Ausbildung offensteht und geebnet wird.
Wenn wir uns darüber hinaus auch dazu durchringen könnten, die bisher noch weit verbreitete Auffassung aufzugeben, daß es zur standesgemäßen Übung gehöre, Kinder von Akademikern auf alle Fälle wieder einer akademischen Berufsausbildung zuzuführen, obwohl ihre Veranlagung oder vielleicht sogar ihr eigener Wunsch gar nicht auf eine wissenschaftliche, sondern praktische Berufstätigkeit ausgerichtet ist, dann hätten wir einen weiteren sehr positiven Beitrag dazu geleistet, daß sich das soziologische Spannungsverhältnis zwischen Akademiker und Nichtakademiker mit der Zeit löst.
Eine sehr wichtige psychologische Voraussetzung dafür, daß die manchmal von Mißtrauen beseelte Abwehrhaltung gegenüber dem akademischen Berufsstand beseitigt werden und an ihre Stelle eine überzeugte Anerkennung treten kann, ist die Bereitschaft der Akademiker, ihr Wissen und Können auch der so wichtigen und verbindenden Volksbildungsarbeit zur Verfügung zu stellen. Wir haben kein Recht, das uns nicht nur durch eigenes Verdienst, sondern auch durch ein gnädiges Schicksal zuteil gewordene Wissen in persönliche Erbpacht zu nehmen und bildungshungrigen Menschen, denen das Schicksal eine höhere Ausbildung versagt hat, von Kenntnissen auszuschließen, die wir ihnen vermitteln könnten. Volksbildung richtig betrieben, schafft keine unsaubere Konkurrenz, sondern öffnet die mannigfachsten Wege zum gegenseitigen Verstehen und zur gegenseitigen Achtung.
Wenn es richtig ist, daß die Einwertung des Akademikers heute nicht mehr allein nach seiner höheren Bildung, sondern nur noch nach der Qualität seiner Berufsleistung sich vollzieht, dann bedeutet dies für jeden einzelnen Akademiker die Verpflichtung, sich zumindest auf seinem speziellen Wissensgebiet ständig zu bemühen und sich auf der Höhe zu halten. Das Ansehen des Berufsstandes des Akademikers beruht nicht auf einer imaginären Vorstellung von den Gesamtleistungen dieser Berufsgruppe, sondern auf der Leistung des einzelnen. Wer sein akademisches Studium nicht aus innerer Berufung zur Aufgabe, sondern nur als Voraussetzung für den am Ende des Studiums erreichbaren Berufsnachweis betrachtet, wird alsbald nach Erreichung der angestrebten Berufsstellung Gefahr laufen, sich im wesentlichen mit der wissenschaftlichen Ausbildung zu begnügen, die ihm Schule und Hochschule in Vorbereitung auf das Examen vermittelt hat. Da man aber nicht ein ganzes Leben ungestraft an dem naturgemäß immer dünner werdenden Schulwissen herumknabbern kann, führt solches Verhalten fast zwangsläufig zum Leistungsabfall und ordnet den Selbstgenügsamen dieser Art in den Augen seiner Mitmenschen in die Kategorie der bedeutungslosen und unterdurchschnittlichen Akademiker ein, auf die die mit Macht aufwärts drängenden Nichtakademiker so gern hinweisen, um ihre sachlich falsche und für die Akademiker insgesamt höchst gefährliche Theorie zu begründen, daß der Führungsauftrag und Führungsanspruch des Akademikers sachlich nicht mehr begründet sei und nur noch einer überlebten Tradition entspreche.
Der Berufsstand des Akademikers muß in jedem einzelnen seiner Teile von einem echten, zutiefst verpflichtenden Berufsethos getragen sein, das nichts zu tun hat mit der Sicherung der materiellen Lebensgrundlage des einzelnen, sondern erfüllt sein muß von dem inneren Drang und der Verpflichtung, sich auch nach Erreichung eines Berufszieles ständig weiterzubilden und damit die Voraussetzungen zu schaffen, die für eine pflichtgemäße Erfüllung des Lebensberufes unabdingbar sind.
Aber nicht nur die Verbreitung und Vertiefung des Berufswissens gehört zur Aufgabe des heutigen Akademikers. Er muß auch aus der bildungsmäßigen Isolierung des Spezialisten herausstreben in die weiten Gefilde einer umfassenden Allgemeinbildung. Dies ist heute, da das Spezial-Studium an den Universitäten und Hochschulen, die früher zu jeder akademischen Bildung selbstverständlich gehörenden allgemeinen Wissensgebiete aus den Prüfungssälen der meisten Fakultäten verdrängt hat, nötiger denn je. Ich möchte jedem jungen Akademiker dringend raten, trotz der Überfülle des Fachstoffs und der schon aus finanziellen Gründen verständlichen Eile, das Studium raschestens abzuschließen, schon auf der Hochschule die kaum mehr so günstig wiederkehrende Gelegenheit nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen, ohne sich auch in den allgemein-bildenden Wissenszweigen Erkenntnisse vermitteln zu lassen, auf denen er später dankbar selbst weiterbauen kann. Je höher in den akademischen Berufsständen neben dem Fachwissen auch das Niveau der allgemeinen Bildung ist, um so sicherer und fundierter wird sich im Leben auch das eigene Urteilsvermögen des Akademikers in den allgemeinen und politischen Lebensfragen unseres Volkes erweisen. Nur dann wird sein Urteil auch über sein Spezialgebiet hinaus Schwerkraft haben und gestaltenden Einfluß gewinnen können. Niemand kann sich in unseren Tagen mit Erfolg auf einen Führungsauftrag oder gar Führungsanspruch berufen, der nicht zuvor seine Führungsqualifikation unter Beweis gestellt und die anderen sachlich davon überzeugt hat.
Zur Mitarbeit berufen in Staat, Gemeinschaft, Kirche
Theo Hauth
Wenn unsere Zeit in etwas groß ist, dann ist sie es im raschen Wort und in den flächigen Schlagzeilen. Das gilt für alle, es gilt auch für uns im KV. Kaum sind die Fragen gestellt: Wie stehen wir KVer im Staat, wie in der Gemeinschaft, wie in der Kirche? ist die Antwort gleich bei der Hand: Bei uns ist doch alles in Ordnung; kein Zweifel über unsere Stellung im Staat, die wir der Republik den großen Kanzler geschenkt haben; im Gemeinschaftsleben fehlt gar nichts, wo viele Korporationen den sozialen Gedanken sogar zum Vierten Prinzip erheben wollen. Und in der Kirche gar genügt ein Wort: Katholische Aktion! Es gibt so manchen, der meint, richtig seien diese Ausführungen wohl, aber ein wenig oberflächlich.
Wie stehen wir zum Staat?
Vorweg, mit dem Bundeskanzler Adenauer haben die „wir" noch nichts von einer persönlichen Pflicht erfüllt. Es ist nie unbedenklich, zum Nachweis eigener Tugend auf den großen Nachbarn zu verweisen. Der Kanzler ist nicht unser Eigentum und erst recht nicht unsere Rechtfertigung. Wir müssen schon (mit eigenen Lungen Staatsluft atmen und) auf eigenen Füßen die Straßen öffentlichen Lebens wandern auf die Gefahr hin, daß unsere Schuhe staubig werden.
Die Stellung zum Staat ist letzten Endes nichts weiter als die Politik in Meinung und Tätigkeit. Politik nun wird im Abendland in den Parlamenten gemacht; die aber Sitz, Gehaben und Gesetze im Parlament bestimmen, sind die politischen Parteien. Wir wollen keinen Augenblick so naiv sein, zu glauben, mit dem Stimmzettel oder der politischen Überzeugung werde das Weltgeschehen gelenkt. Ob Währungen gesenkt oder Armeen aufgestellt, ob Kanäle gesperrt oder Atome gespalten werden, das entscheiden weder wir bei der nächsten Wahl, noch entscheidet es Bonn oder München oder Düsseldorf; aber anderes entscheiden wir oder könnten wir entscheiden, wenn wir mittun: Fragen des sozialen Lebens bis in die Bochumer Begeisterungs-These von der Mitbestimmung; Beweise der sozialen Gesinnung auf der untersten Ebene, im Büro, im Betrieb, auf der Straße, auch in der Familie; Schulbildung der Kinder, sei es im Kirchenstreit in Niedersachsen oder in den Schuleinschreibungen in Bayern; Ehefragen, ob man mit drei geschiedenen Jahren die Scheidung erdienen könne; Gleichheit der Geschlechter, ob die Natur sich geirrt hat oder die Auslegung des Art. 3 zum Grundgesetz; Steuerrecht mit seinen Auswirkungen auf den Doppelverdienst und die Ehrlichkeit, seinen feinsten kaum noch geglaubten Verästelungen bis in die Entstehung und Erziehung von Kindern. Es ist, wenn wir uns selber ernst nehmen, nicht mehr eine Frage des freien Willens, sondern der Verantwortung, ob wir hier mitsprechen oder nicht. Jenseits von allem aber können wir eines nicht: Vornehme Zurückhaltung vor dem Schmutz der politischen Straße üben.
Ist dies ein Wort an die Allzulauen, dann darf ein zweites an die Allzuforschen nicht fehlen. Wer etwas bedeuten, wer etwas werden will in der Politik, soll erst etwas sein im Leben und Beruf. Es ist nun einmal ein anderes, Führer in einer Jugendgruppe oder auch Experte im Wilton Park zu sein, und es ist ein anderes am Staatsleben maßgeblich teilzunehmen. Der homo politicus ist gut, aber wer nichts ist wie ein Partei-Boß, kennt nur ein Streben: ein Parteiamt oder Mandat zu erhalten und zu behalten. Er ist nicht Träger einer politischen Meinung, sondern die Nummer 17 oder 53 im Fraktionszimmer. Nur wer eine erlernte und erdiente bürgerliche Existenz hat, kann zur Meinung der Parteigewaltigen auch „nein" sagen und sein „ja" damit doppelt wertvoll machen. Ein Zweites aber: Es ist nicht notwendig, über Bestehendes zu schimpfen, um sich für die Zukunft interessant zu machen. Die Männer von morgen sollten wissen, daß nichts, aber auch nichts sich bei uns in den nächsten zehn Jahren ereignen wird, was wir nicht auf irgendeine Art und Weise den vergangenen sieben Jahren verdanken. Ein Drittes endlich: Im Weg, den wir politisch gehen, sind wir zugegebenermaßen beschränkt. Solange es Parteien gibt, die sich christlich nennen und so führen, stehen sie uns nahe. In der Zusammenfassung Eines: Die kleinste eigene politische Leistung des einzelnen ist in der Stellung zum Staat bedeutender als die Meisterarbeit des großen anderen.
Wie stehen wir zur Gemeinschaft ?
„Nun, hier fehlt schon gar nichts. Wir haben ja vielfach den sozialen Gedanken schlechthin zum Vierten Prinzip gemacht. In jeder Stiftungsfestrede bekennen wir uns zur Gemeinschaft, wir laden uns gegenseitig zu unseren Festen ein und im Werkvolk und bei den Kolpingbrüdern halten wir laufend Vorträge." Wenn das, was wir vor hundert Jahren beschlossen haben zu tun, nicht mehr ausreicht, unser Dasein zu bejahen, dann sollten wir die Türen schließen, nicht aber neu anstreichen. Man wird den Gedanken nicht los, es sei dieses Vierte Prinzip so etwas wie eine Entschuldigung an die Jetztzeit. Dabei gibt es außer einigen Neuerungssüchtigen, einigen Feuilletonisten und einigen Unbelehrbaren (aus fremdem, aber bisweilen auch aus katholischem Lager) gar niemanden, der überhaupt eine Entschuldigung von uns verlangt. Ein zweites Wort dient der Klarheit: Studentische Korporationen sind, ob wir es nun so übersetzen oder nicht, Vereinigungen von Akademikern. Sie sind damit kein Nachweis sozialer Gesinnung, sie sind nicht einmal Ausdruck sozialen Denkens, sondern Prägungen ständischer Auffassung.
Wer eine Vereinigung von Akademikern dem sozialen Gedanken weiht, handelt, trivial gesagt, wie ein Mensch, der Wasser und Wein in einem Kruge aufbewahren will; getrennt sind sie beide wertvoll, vereint wird der Wein dünn und ohne Feuer, aber auch das Wasser verliert die Eignung guter Mokka zu werden. Das ginge alles noch hin, wichtiger ist, anderes zu erkennen:
Was immer wir in unseren Korporationen tun für den sozialen Gedanken ist hoch und edel, aber doch nur Geplänkel im Vorfeld. Der wahre Wert unserer Stellung zur Gemeinschaft zeigt sich in anderem, in der täglichen Tat des einzelnen; hier nicht schlechter zu sein als andere macht uns wertvoll. Nicht jeder kann Glanzstücke liefern, Bergknappen-Häuser bauen oder die Leitung seines Betriebes dem Stimmrecht auch des kleineren Arbeiters überlassen. Anderes kann jeder: Der Herr Sanitätsrat, der den alten Griesgram auf Krankenschein so selbstlos und gut gelaunt behandelt wie den Freund mit dem großen Weinkeller, der Herr Justizrat, der dem langweiligen Geplapper des stets verfolgten Mieters ebenso geduldig zuhört wie dem Diktat des Kaufmanns, aus dem der Prozeß mit dem Hunderttausendmark-Streitwert entsteht und Hochwürden Herr Geistlicher Rat, der am Weißen Sonntag, von vielen Eltern eingeladen, in die Zweizimmerwohnung des Sparkassenangestellten geht, um einen Schweinebraten mit Sauerkraut zu essen, und dabei den Gönner-Fabrikanten mit dem wunderbaren Menue im Grand Hotel dieses Mal vernachlässigt. Sozialtagungen, große Reden über die weniger gelesene aber viel gepriesene rerum novarum in allen Ehren, ich aber meine, gelebte soziale Haltung ist wertvoller als gelehrte. Freundlichkeit gegenüber jedermann, Hilfsbereitschaft in der Hausgemeinschaft und Nachbarschaft. Die wirtschaftliche Unterstützung nicht den Organisationen überlassen, weil deren Hilfe oft die menschliche Wärme fehlt.
Wie aber stehen wir zur Kirche ?
„Alles in Ordnung, seit fünf Jahren Vorsitzender des Bezirksausschusses der Katholischen Aktion, erst im letzten Winter zwei Vorträge über das abendländische Schisma und den modernen Wunderglauben, heuer Pilgerfahrt nach Rom, nächstes Jahr Jubiläumsreise nach Lourdes." Nein, damit ist noch nichts in Ordnung. Auch hier zuerst ein Wort der Warnung: Die Katholische Aktion ist in Gefahr jedesmal, wenn sie festlich geredet, und jedesmal, wenn sie in Komitees organisiert wird. Und unsere Wallfahrten? Sie sind ein landschaftliches, sind ein kulturelles Erlebnis, sie sind ein gesellschaftliches Ereignis, ein religiöses weniger; auch wenn der Besuch der Katakomben, der vier Kathedralkirchen und die Papst-Audienz, wie im Reiseprospekt vorgesehen, von dem rührigen Führer perfectiert wird. Stellen wir absolut profan und für manchen Geschmack ein Stück zu nüchtern fest: Eine Studentenverbindung ist keine Gemeinschaft, die ausschließlich der Heiligung ihrer Mitglieder dient. Aber — hier folgt das große Aber — unser Platz in der Kirche sieht doch anders aus als der Vereinsbetrieb, der Vortrag und die Fahrt ins Ausland mit Gleichgesinnten. Unseren ersten Platz suche ich im Gotteshaus. Der katholische Akademiker gehört wie jeder andere katholische Mensch in seine Pfarrkirche. Dort ist er oft der schmerzlich vermißte Fehlende oder ebenso oft der stolz Festgestellte seiner Gemeinde. Gewöhnen wir uns doch endlich daran, das Ursprüngliche oder Einfache zu tun und unsere religiösen Pflichten weder mit der Sprachgewalt der Leppich-Predigt noch mit dem Geigenglanz der Mozartmesse abzutun. Unser zweiter Platz ist neben dem Pfarrer.
Es ist gewiß wertvoll, Consultor des Bischofs zu sein in den großen Fragen des Konkordats; es ist aber viel wichtiger, ständiger Berater des kleinen Pfarrers zu sein. Wir haben ja keinen Begriff davon, wie notwendig uns der Pfarrer braucht. Letzten Endes ist er arg allein. „Der Umgang nur mit Schwarzen ist der Schwarzen Not!" Wenn die Welt in ihrem Laster oder in ihren kleinen Fehlern durch das Gitter des Beichtstuhls an ihn herantritt, ähnelt er irgendwie dem Gefängnisdirektor, der lauter Vorbestrafte um sich herum hat, oder dem Nervenarzt, dessen Umgang nur aus Kranken besteht; er oder die Welt steht schief. Sonst kommen die Menschen zu ihm nur als dem Allsorgenden und Allwissenden. Er braucht fürwahr einmal, wenn sie seelische oder materielle Hilfe wollen, einen anderen, der nichts von ihm will, der ihm etwas sagen kann, was er noch nicht weiß. Ein dritter Platz aber ist die Schulbank der religiösen Lehre. Manchmal möchte man meinen, die Kirche vernachlässige die Seelsorge der Akademiker. Es war einmal so, daß die französische Intelligenz den Geist des Unglaubens ins Abendland hineintrug. Ob es nicht das Zeichen des 21. Jahrhunderts sein könnte, daß die westliche Intelligenz eine Welle neuen Glaubens in die Welt trägt? Dazu sollten wir gerüstet werden und uns rüsten. Wir wissen vieles über den Modernisten-Eid, das Tridentinum oder den Kirchenbau des Hochbarock, manchmal allerdings versagen wir auf die Fragen unseres naseweisen Töchterleins, obwohl die Antwort im Katechismus steht; schlimmer aber ist es noch, daß wir dem geschulten Protestanten an Wissen, dem Jünger des dialektischen Materialismus an Logik und dem Bibelforscher an Glaubensfreude nachstehen.
Meine Gebrauchsanweisung für das kirchliche Leben scheitert weder am Geld, noch am Geist, nicht einmal an der Zeit, sie könnte höchstens am guten Willen scheitern.
Apostolat der Verbände
Erzbischof Dr. Jaeger, Paderborn
Die studentischen Verbände haben nach dem Zusammenbruch unseres Volkes wertvolle Sammlungsarbeit geleistet, indem sie ihre Angehörigen aus dieser Zerstreuung wieder heimholten in die unter hohe und verpflichtende Ideale gestellte bundes- und kartellbrüderliche Gemeinschaft. Ich sehe darin eine für Volk und Kirche gleicherweise wertvolle Arbeit, zu der man den Verbänden nur gratulieren kann, für die jeder unvoreingenommen Denkende ihnen dankbar sein muß. Geht es doch beim Wiederaufbau der studentischen Verbände um nichts weniger als um den in der modernen Massengesellschaft und zuletzt durch den kollektivistisch denkenden totalen Staat in die Isolierung gedrängten Menschen wieder zu wahrer, in Freiheit und Verantwortung gelebter Gemeinschaft zu führen. Jede echte, wirklich gelebte Gemeinschaft wirkt dem immer noch großen Sog des Kollektivismus entgegen, der gar nicht ernst genug genommen werden kann, und befähigt den Menschen durch das Erlebnis wirklicher Gemeinschaft die Atomi-sierung unseres sozialen Lebens, seine Aufspaltung in rivalisierende Macht- und Interessengruppen zu überwinden. Nach den Jahren der Sammlung muß jetzt eine Zeit der inneren Vertiefung und des Wirkens nach draußen im Sinne des „Apostolates des Geistes" folgen. Es gilt, von innen heraus in Christus erneuerte Persönlichkeiten zu formen und für die einem jeden in seinem Beruf aufgegebene apostolische Verantwortung auszurüsten.
Gerade auch die studentischen Verbände und Korporationen sollen der Ort sein, wo alle aus dem einen Wurzelgrund christlicher Existenz, aus Christus und seiner Kirche, sich für ihre Lebensaufgabe schulen, wo aber auch jene Elite herangebildet wird, ohne die eine wirksame Neuordnung der Welt aus dem Geist sozialer Gerechtigkeit und Liebe und die Wegbereitung des Reiches Gottes in alle Bereiche menschlichen Lebens hinein nicht möglich ist.
Aus dem Grußwort zur Hundertjahrfeier des KV-Studententums.
Aus der Welt des Studenten
Aus der Geschichte des deutschen Korporationsstudententums
Siegfried Hermsteiner
Bunt, ja verwirrend vielgestaltig — deutsches Korporationsstudententum. Noch blüht diese Oase mitten in Uniform und Gleichschritt unserer Zeit. Mannigfaltigkeit nicht allein der Farben und Formen — wo wären sie geblieben! — sondern der gestaltgebenden geistigen Fundamente. Wer an die Wurzeln des Korporationswesens gelangen will, muß bis in die Anfänge abendländischer Universitätsgeschichte zurückgehen. Bologna und Paris, beide Universitäten kennen die Einteilung der Scholaren in Nationen, die aber grundverschieden sind.
In Paris werden Nationen 1222 erstmalig erwähnt, 1249 wird als ihre fortan gültige Zahl vier angegeben. Sie stellen jedoch keine freien Vereinigungen der Scholaren dar, sondern sind rein verwaltungsmäßige, von den Magistern zur besseren Beaufsichtigung geschaffene Institutionen. Die Machtstellung des Lehrkörpers und die spätere straffe Organisation in den Kollegien, jenen Wohn-, Eß- und Lerngemeinschaften, deren erste 1257 durch Robert von Sorbon gegründet wird, machen jeden selbständigen Zusammenschluß der Scholaren unmöglich.
Bevormundung in Paris, weitgehende Selbstbestimmung und eigene Gesetze der Studierenden in Bologna. Sie bilden zwei große „universitates" (für die Lehranstalt ist das ganze Mittelalter hindurch die Bezeichnung „Studium generale" üblich), an deren Spitze je ein Rektor steht, der aus der Mitte der Scholaren gewählt wird. Alle Italiener gehören zur „universitas citramontanorum", die sich in drei Nationen untergliedert, und alle Nichtitaliener verteilen sich auf die vierzehn Nationen der „universitas ultramontanorum", unter denen die deutsche eine bevorzugte Stellung einnimmt. Der Rektor der universitas erhält zahlreiche Befugnisse nur „salvo iure Teuthonicorum", und mindestens alle fünf Jahre muß ein Deutscher dieses Amt bekleiden. Die freie Entfaltung dieser Scholarenorganisationen kann weder von den Magistern noch den städtischen Behörden entscheidend geschmälert werden.
Für die Verhältnisse an den deutschen Universitäten des Mittelalters konnte Bologna nicht als Vorbild dienen, sie wurden nach Pariser Muster gegründet. Auch die Wohnverhältnisse waren ähnlich wie in Paris geregelt. An die Privilegien der Magister schlössen sich verschiedene Scholarenräume an: die Burse. An allen Universitäten herrschte Bursenzwang, der Tageslauf des Scholaren war auf das genaueste geregelt. Für freie Vereinigungen war kein Platz.
Ein Wandel tritt erst ein, als sich im Zuge der Reformation die Bursen auflösen und die Zeit des modernen Studententums anbricht. Nun vollzieht sich das erstaunliche. Der Student (diese Bezeichnung hat das früher übliche „scholaris" oder „clericus" seit etwa 1500 verdrängt) verneint nicht, froh der endlich gewonnenen Freiheit, jede neue Bindung, sondern schließt sich mit anderen zu einer Korporation zusammen. Er muß in dieser freiwilligen Gemeinschaft also wohl einen Faktor gesehen haben, der für sein Studentenleben zentrale Bedeutung hatte.
Bände würde der Versuch füllen, die damit beginnende Herausbildung der verschiedenen Korporationsarten und ihre Geschichten in Einzelheiten darzustellen. Dieser Abriß soll sich deshalb darauf beschränken, heute noch gültige korporative Formen auf ihren Ursprung hin zu untersuchen und so einen ganz kurzen Überblick über die deutsche Korporationsgeschichte geben.
Die ersten Verbindungen
sind landsmannschaftliche Vereinigungen. Mit ihnen werden die Eigenart und die Gegensätzlichkeit der deutschen Stämme, auf die so viele Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Kultur zurückzuführen sind, auch für den studentischen Raum fruchtbar. Diese ersten Landsmannschaften, die wie die deutsche Nation in Bologna ihren Mitgliedern eine soziale Fürsorge angedeihen lassen, Geld vorschießen, Kranke pflegen, Toten ein würdiges Begräbnis bereiten und die Verbindung mit der Heimat aufrechtzuerhalten versuchen — behördlich sind sie übrigens verboten —, schenken uns gleich die bis auf den heutigen Tag geltende Einteilung der Korporationsstudenten in Burschen und Füchse. Die Bezeichnung „Fux" oder „Fuchs" kommt allerdings erst in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts in Gebrauch, nach Schnabel sogar erst um 1720. Rühmlich heben sie sich durch diese rein studentische Stufung von der übrigen Studentenschaft ab, in der sich nach dem Wegfall des durch die Burse garantierten einheitlichen Charakters immer deutlicher soziale Schichten abzuzeichnen beginnen. Der neu Eintretende muß ein „Pennaljahr" durchlaufen, in dem er von den „Schoristen" oder „ehrlichen Burschen" erzogen wird, freilich höchst sonderbar. Der Pennal darf sich keine modische Kleidung leisten, muß die älteren Burschen bewirten, bei den Kneipen aufwarten, zahlreiche Torturen über sich ergehen lassen, die auf die Depositionsgebräuche der Pariser Kollegien zurückgehen usw. Am Ende des Pennaljahres, das gewöhnlich 1 Jahr, 6 Monate und 6 Tage dauert, hat er um „Absolution" einzukommen; wird sie gewährt, so zahlt er eine Aufnahmegebühr und richtet ein Gelage aus. Die Roheiten des Pennalismus führen zu energischem Einschreiten der Universitätsbehörden, dem bald alle Landsmannschaften zum Opfer fallen.
Neue, zukunftsträchtige Entwicklungen
...bringt das 18. Jahrhundert. Das frische Blut, das den Universitäten durch das aufstrebende Bürgertum um die Mitte des Jahrhunderts zugeführt wird, erweckt die alten Verbindungsbestrebungen wieder zum Leben. Zunächst entstehen aus Tischgesellschaften neue Landsmannschaften, deren Anfänge aber, durch das behördliche Verbot bedingt, völlig im Dunkeln liegen. Ihre Grundsätze lauten zusammengefaßt etwa so: Freundschaft, Verteidigung gegen Fremde, gemeinsame Geselligkeit und Unterordnung unter den Mehrheitsbeschluß. Besonders durch die Herausstellung des Gedankens der Wehrhaftigkeit werden sie richtungweisend für die kommenden Studentengenerationen. Noch fehlt ihnen die straffe Organisation. Das ändert sich erst, als sie beginnen, ihre Gesetze aufzuzeichnen. Die Handhabung überträgt man dem Senior, dessen Ansehen nun mächtig steigt, der jetzt oft das Gesicht einer Korporation bestimmt.
Ihre weitere Ausbildung, ja Überspitzung finden diese Bestrebungen in der zweiten großen Korporationsform des 18. Jahrhunderts, in den Orden. Diese aus freimaurerischem Geiste erwachsenen Gebilde bestehen anfangs als rein örtliche Zusammenschlüsse neben den Landsmannschaften. Das Verhältnis ändert sich mit der Gründung der vier großen Ordensbünde der Amizisten, Unitisten, Konstantisten und Harmonisten seit etwa 1770. Sie bilden sich innerhalb von Landsmannschaften als ihr engerer, innerer Ring. War schon bei den Landsmannschaften im Laufe ihrer Festigung von der losen Gesellung zur geschlossenen Korporation die Aufnahme immer strenger gehandhabt worden, so gestaltet sie sich bei den Orden nach dem Vorbild der Freimaurerlogen bald zu einem feierlichen Ritus, der von den meisten späteren Verbindungsarten nachgeahmt wird. Von der übrigen Studentenschaft schließen sich die Orden bewußt ab, sie betrachten sich als ihre aristokratische Oberschicht. Unter diesem Gesichtspunkt treffen sie auch die Auswahl ihrer Mitglieder, und leider sind meist die Tüchtigkeit im Fechten und ein hoher Wechsel von größerer Bedeutung als geistige oder sittliche Qualifikationen. Nicht zu verkennen aber ist ihr Zusammenhalt, der einmal durch strenge Disziplin, zum anderen durch den von den Landsmannschaften übernommenen und zum konstituierenden Prinzip erhobenen Grundsatz der Freundschaft und Bruderhilfe garantiert wird. Ihre große Bedeutung erhalten die Orden durch zwei Neuerungen, ohne die man sich heute korporatives Leben gar nicht mehr denken kann. Während man bisher nur für die Dauer seines Aufenthaltes an einer Universität bzw. seiner Studienzeit einer Korporation verbunden war, schaffen sie den Begriff des Lebensbundes. Bei den Jenaer Amizisten heißt es 1791: „Da der Endzweck unserer Verbindung lebenslängliche Freundschaft ist, so ist jedes Mitglied gehalten [...] unter keinen Umständen in eine andere Verbindung zu gehen". Noch setzt der Gedanke sich nicht allgemein durch, und die „Provinziallogen", die man für abgegangene Mitglieder einrichtet, sind meist nur kurzlebig, doch bilden sie die Anfänge unseres heutigen Altherrentums. Aus Landsmannschaften waren die vier großen Ordensbünde entstanden, aus ihnen rekrutierten sie sich auch größtenteils, sie selbst aber zeichnen sich durch ihre überregionalität aus. So machen die Amizistengesetze die Aufnahme eines Mitglieds nur von seiner Tauglichkeit und dem Urteil der Ordensbrüder abhängig, „unter welchem Himmelsstrich übrigens auch sein Vaterland liegen ... mag".
Unterschiedlich ist die Stellung der „Kränzchen" zu diesem Grundsatz. Neben Orden und Landsmannschaften waren sie, begünstigt durch die behördliche Duldung, als dritte Verbindungsform aufgeblüht. Während z. B. die Erlanger Onoldia durch die Übernahme und Weiterentwicklung der neuen Gedanken vorbildlich für die Zukunft wird, wettert Jahn 1801 aus Frankfurt a. d. O. über die landsmannschaftliche Abkapselung der dortigen Kränzchen. Mit den Orden sind sie in einen leidenschaftlichen und haßerfüllten Kampf verwickelt. Beide überleben das 18. Jahrhundert kaum und gehen mit seinem Geiste, der sie groß machte, unter.
Geradezu kläglich erscheinen die Versuche, regionale Beschränktheit und Enge abzuschütteln, vergleicht man sie mit der elementaren Wucht und der Zielsetzung, zu der sie in der...
Burschenschaftsbewegung
...reifen. Es ist unmöglich, in der gebotenen Kürze ihre Ursprünge aufzuzeigen und dieser großen Erhebung gerecht zu werden. Wie in keiner anderen Volksschicht war in der akademischen Jugend während der Jahre napoleonischer Besetzung der Gedanke an ein freies und geeintes Deutschland genährt worden, der die Studenten scharenweise in die Freikorps trieb. Tief klaffte der Widerspruch der Erwartungen und des Lohnes, der ihnen bei ihrer Rückkehr zuteil wurde. Aber sie dachten nicht daran, sich mit der Restaurierung der alten übelstände abzufinden; „es war ihr heiliger Wille, die sittliche und religiöse Kraft jener Jahre nicht wieder verkommen zu lassen und die Güter, die sie auf den Schlachtfeldern erstritten, auch im Alltag des Friedens festzuhalten". (Schnabel, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert S. 234.) Den Anfang soll die Einigung ihres Raumes machen. Doch bald schon wird ihre Bewegung zum Fanal für das ganze Volk, und seit dieser Zeit „hat der deutsche Student im Denken und Fühlen der Nation jene volkstümliche Stellung gewonnen, die dem deutschen Leben besonders eigentümlich ist und die weder in Frankreich noch in England denkbar wäre". (Schnabel a. a. O. S. 234.) Von Jena aus, wo am 12. Juni 1815 die erste Burschenschaft ins Leben getreten war — Jena bot für Einigungsbestrebungen einen fruchtbaren Boden, denn es war keine reine Landesuniversität und besaß in seinem Großherzog Karl August einen einmaligen Landesherren — loht die Bewegung bald über Erlangen, Heidelberg, Gießen, Marburg und Tübingen. Am 18. Oktober 1817 findet das gemeinsame Streben seine erste große Dokumentation in dem Fest auf der Wartburg, das in der Mahnung gipfelt, „daß nimmer in uns erlösche das Streben nach Erkenntnis der Wahrheit, das Streben nach jeglicher menschlichen und vaterländischen Tugend". Hier muß einmal deutlich betont werden, was klar aus diesen Worten spricht, aber immer wieder falsch dargestellt wird: die Burschenschaft war in ihren Anfängen nicht politisch! Ihre Sorge galt zunächst tiefgreifenden Reformen innerhalb der Studentenschaft, die zur Grundlage ihrer Einigung werden sollten, diese wiederum war als Vorbild für die Schaffung der nationalen Einheit gedacht. Dabei vereinigte die Burschenschaft religiöse, sittliche und soziale Kräfte. Das religiöse Element zeigte sich in der bewußten Bezugnahme des Wartburgfestes auf die 300-Jahr-Feier der Reformation, in gemeinsamen Gottesdiensten usw. Auf sittlichem Gebiet kämpfte man gegen Glücksspiel, Saufereien, geschlechtliche Verirrungen und sinnlose Paukereien. Ihre soziale Seite bewies die Burschenschaft in der Aufnahme auch ärmerer Studenten, der absoluten Gleichberechtigung aller Mitglieder und in der Sorge um ein einträchtiges Zusammenleben mit der Bürgerschaft.
Groß sind die Anfeindungen, die sich bald nach dem Wartburgfest, besonders hervorgerufen durch das bekannte „Flammengericht", das mit dem Fest gar nichts zu tun hatte und ohne Wissen des Festausschusses vollzogen wurde, gegen die Burschenschaften richten. Dennoch gelingt im Oktober 1818 der Zusammenschluß zur "Allgemeinen Deutschen Burschenschaft". Die dauernden Angriffe und die schwindenden Aussichten auf ein geeintes Vaterland führen zur Bildung eines radikalen Flügels, der sich in den „Unbedingten" um Karl Folien in Gießen sammelt und die Meinung vertritt, Worte nützten nichts mehr, man müsse zu Taten schreiten. Aus dieser Haltung heraus ist die Ermordung Kotzebues durch den Burschenschafter Sand zu verstehen. Die Antwort darauf sind die berüchtigten „Karlsbader Beschlüsse" vom 20. September 1819, die in ihrem die Studentenschaft betreffenden Abschnitt fordern, daß von den bestehenden Gesetzen gegen geheime Verbindungen an Universitäten verschärft Gebrauch gemacht werden soll und daß sie auch besonders auf die Burschenschaft anzuwenden sind. Kein Mitglied einer solchen Verbindung dürfe zu einem öffentlichen Amt zugelassen werden.
Zwar bestehen viele Burschenschaften im geheimen weiter, sogar Burschentage werden abgehalten, doch die Einheit ist verloren. Auch die 1827 neubegründete Allgemeine Deutsche Burschenschaft bleibt innerlich zerklüftet. Sie, einst Führerin aller Einigungs- und Reformbestrebungen, muß zusehen, wie andere diese Aufgabe übernehmen, so in der „Progreßbewegung" der bislang von den Korporationen an die Wand gedrückten Freistudenten um 1840, von der die Burschenschaften am stärksten geschüttelt werden. Sammlungsversuche kommen über kleine Kartellbildungen nicht hinaus, und 1871 geht ihnen mit der Verwirklichung ihres Traumes von dem geeinten Deutschland auch noch die leitende Idee verloren. Erst 1881 schließen sich 33 Burschenschaften zum „Allgemeinen Deputierten-Convent" (ADC) zusammen. Seine Entwicklung wird noch einmal gestört durch die von Dr. Konrad Küster ins Leben gerufenen „Reformburschenschaften", die sich 1883 im Allgemeinen Deutschen Burschenbund sammeln und gegen übertriebenen Luxus und Mensursimpelei kämpfen, er gelangt aber 1886 zu einer Festigung durch die Herausstellung eines Programms. 1902 wird er in „Deutsche Burschenschaft" umbenannt, und um die gleiche Zeit finden auch die auf den Technischen Hochschulen entstandenen Burschenschaften einen Zusammenschluß im „Rüdesheimer Verband Deutscher Burschenschaften".
Im Programm von 1886 und auch bei der Neubegründung der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft 1827 wird klar ausgesprochen, was schon aus den Reformbestrebungen der Urburschenschaft zu ersehen war: die Burschenschaften sahen ihre Hauptaufgabe in der Erziehung ihrer Mitglieder zu verantwortungsbewußtem sittlichem und vaterländischem Handeln. Der Erziehungsgedanke als korporatives Prinzip war schon bei den Kränzchen aufgetaucht, am klarsten wiederum in der Erlanger Onoldia; sonst scheint er nicht sonderlich in die Praxis umgesetzt worden zu sein. Aufgegriffen wird er von den
Corps
Diese Bezeichnung taucht 1810 erstmalig für die, wie wir gesehen haben, immer geschlossener gewordenen Landsmannschaften auf. Die Corps erstreben eine ehrenhafte Ritterlichkeit ihrer Mitglieder, bekennen sich zwar zur unbedingten Satisfaktion, wenden sich aber ebenso wie die Burschenschaft gegen unbegründete Paukereien. Sie erreichen sogar allgemein eine gewisse Besserung des Studentenlebens, geben dem Ehrenwort seine Bedeutung zurück und können durch ihre Verrufserklärungen zahlreiche übelstände ausmerzen. Leider verflachen ihre Erziehungsbemühungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
In den Corps findet das korporative Element seine stärkste Ausprägung. Sie machen sich alle als zukunftstüchtig erkannten Formen zu eigen und bilden sie weiter aus. Anfangs überwog noch ihr landsmannschaftlicher Charakter, und manche Corps sind lange landsmannschaftlich geblieben. Sie pflegten sogar die gesamte Studentenschaft einer Universität in Kantone aufzugliedern, die sie als Rekrutierungsgebiete unter sich verteilten. So fühlte sich auch ihr Seniorenconvent (S.C.) als Vertretung der Gesamtstudentenschaft. Aber in der Auseinandersetzung mit der Urburschenschaft, die sie in eine schwere Krise stürzt, geben sie die Kantonseinstellung auf, und bald spielt die Stammeszugehörigkeit ihrer Mitglieder gar keine Rolle mehr. Der von den Orden herausgestellte Gedanke des Lebensbundes findet zunächst nur in den Lebenscorps Eingang. Ihnen stehen Waffencorps gegenüber, die einen Wechsel der Verbindung erlauben, aber von 1850 an auch zum Lebensgrundsatz übergehen. Auch die straffe Organisation wird von den Orden übernommen. Das zeigt sich schon am Anfang in der Untergliederung der Corps in eine engere und eine weitere Verbindung. In den inneren Kreis werden nur Auserwählte nach Ablegung eines Eides aufgenommen, den äußeren bilden die Verbindungsanwärter (Renoncen), die seit 1820 eigene Farben tragen. Die Corps sind die ersten, die nach dem großen Energieverbrauch von 1848 erkennen, daß es sinnlos ist, seine Kräfte im Kampf um die Einigung der Gesamtstudentenschaft zu verausgaben, sondern daß es jetzt darauf ankommt, bei der durch das erkämpfte Vereinsrecht bedingten Breitenentwicklung des Korporationswesens alle Einzelkräfte zusammenzufassen. Nach einigen vorausgehenden Korporationstagungen gelingt 1855 die Gründung des Kösener Senioren-Convents-Verbandes (KSCV). Diesem Beispiel folgen die Corps auf den Technischen Hochschulen, die sich 1863 zum späteren Weinheimer Senioren-Convent (WSC) zusammenschließen. Noch deutlicher wird die feste Organisation nach 1870/71. Die Corps geben jeden Führungsanspruch nach außen auf, schließen sich ab, konzentrieren alle Kräfte auf den inneren Auf- und Ausbau und werden gerade so durch ihre straffe Verbindungszucht und den von ihnen herausgestellten Typ des Waffenstudenten zum Vorbild, dem man bewußt oder unbewußt nacheifert.
Ein zweites Mal war die Geschichte der Landsmannschaften unterbrochen worden, doch noch einmal konstituieren sich Korporationen, die diesen Namen anlegen, obwohl sie nicht mehr streng das sind, was er beinhaltet.
Als trotz des Druckes der Karlsbader Beschlüsse die Rufe nach Reformen in ganz Deutschland immer lauter werden, schieben sich auch auf den Universitäten die politischen Strömungen in den Vordergrund. Die Burschenschaft hatte auf diesem Gebiet die Führung verloren und es wird nun zum Betätigungsfeld für die Freistudenten, die bei innerakademischen Angelegenheiten bislang nicht mitreden durften. Mit ihrer „Progreßbewegung" stürzen sie das Korporationswesen in eine schwere Krise. Sie argumentieren folgendermaßen: Wenn man schon Freiheit und Gleichheit für das ganze Volk fordert, dann darf man den studentischen Raum nicht ausklammern. Kein Student darf durch Vorrechte gegen Kommilitonen und Bürger bevorzugt werden, kein Korporierter eine andere Stellung als ein Wilder einnehmen und auch innerhalb der Korporationen müssen die Unterschiede zwischen Burschen und Füchsen beseitigt werden. Aus diesen Gründen müssen auch Duell und akademische Gerichtsbarkeit abgeschafft werden, die ebenso eine Begünstigung eines Volksteiles darstellen, überall werden Ausschüsse, sogenannte Allgemeinheiten, gebildet, die sich aus Wilden und Korporierten aller Richtungen zusammensetzen. Am härtesten werden von der Bewegung die Burschenschaften gepackt, aber auch den Corps gehen ganze Verbindungen verloren.
Aus diesem Verjüngungsbad erstehen Gebilde, die sich einerseits gegen den Totalitätsanspruch der Corps wenden, zum anderen auch die politische Betätigung der Burschenschaften ablehnen und eine Mittelstellung zwischen beiden einnehmen wollen:
die neuen Landsmannschaften
Mit zahlreichen Übertritten nach beiden Seiten müssen sie diese Stellung erkaufen. Zu einer Festigung gelangen sie erst 1868 im Allgemeinen Landsmannschafter-Verband. 1873 wird er in Coburger Landsmannschafter Convent umbenannt, der zwar schon 1877 wegen innerer Schwierigkeiten aufgelöst werden muß, aber 1882 neu ersteht. Noch einmal wird er 1898 durch die Abspaltung des Arnstädter Landsmannschafter-Convents empfindlich geschwächt, doch vereinen sich beide Richtungen 1906 wieder unter dem Druck ihrer Alten Herren. 1908 erfolgt die Umbenennung in Deutsche Landsmannschaft.
Waren die bis jetzt aufgezeigten Korporationsarten durch ihren landsmannschaftlichen Charakter oder dessen Überwindung gekennzeichnet, was freilich nicht immer ihr bestimmendes Merkmal war, so haben sich die nun folgenden auf der Grundlage des gemeinsamen Interesses konstituiert.
Die ältesten Verbindungen dieser Richtung sind
die wissenschaftlichen Vereine
Ihre Anfänge liegen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, besonders stark ist ihre Entwicklung in Leipzig. Die meisten verlieren ihren studentischen Charakter bald, nur die 1716 von Wenden gegründete „Lausitzer Predigergesellschaft" (Sorabia), die zur Übung des Predigens in ihrer Muttersprache dienen sollte, nimmt immer stärker deutschen Korporationscharakter an. Die Gründungen des beginnenden 19. Jahrhunderts sind meist theologischer Natur. Einen mächtigen Um- und Aufschwung bringt die zweite Hälfte mit einer großen Menge theologischer, philologischer, historischer, mathematischer und naturwissenschaftlicher Vereine. Die Spezialisierung geht noch weiter mit der wachsenden Bedeutung der Technischen, Tierärztlichen und anderen Hochschulen. Die Zahl der Fachbünde wird unübersehbar. Ein großer Teil von ihnen sammelt sich schließlich 1910 im Deutschen Wissenschafter-Verband.
Sängerschaften
Mit der Gründung eines burschenschaftlichen Singvereins 1816 in Jena beginnt die Entwicklung der studentischen Gesangvereine. 1866 bestehen bereits neunzehn. Anfangs sind sie meist lose Kränzchen, die sich der Pflege des Liedgutes widmen und es im geistlichen wie auch im weltlichen Gesang zu beachtlichen Leistungen bringen, so wirkt die Leipziger Universitätssängerschaft St. Pauli seit 1840 beim Gewandhauskonzert mit. Mitglieder anderer Verbindungen werden allmählich hinausgedrängt, die Kränzchen nehmen immer stärkere Vereinsform an, die künstlerische Leistung wird dadurch noch gesteigert. 1867 schließt der Berliner Verein mit dem Münchener ein Kartell, das sich bald zum Verband Deutscher Studentengesangvereine erweitert. 1897 nennt er sich nach dem Ort seines ersten glänzenden Kartellfestes Sondershäuser Verband. Neben ihm bestehen der 1890 aus dem 1876 gegründeten Altenburger Kartell umgebildete Rudelsburger Kartell-Verband und noch zwei kleinere Kartelle. Weitere Einigungsbestrebungen scheitern immer wieder an den Streitereien über Mensur- und Farbenfragen. Nach mehreren Zusammenschlüssen und Trennungen sammeln sich schließlich noch einige Sängerschaften im Weimarer Chargierten-Convent.
Akademische Turnvereine
Neben dem Gesang bildet das Turnen eine einigende Grundlage. Die nach der Aufhebung der Turnsperre 1842 an verschiedenen Universitäten gegründeten Turnvereine sind nur kurzlebig. Erst der Eindruck des ersten deutschen Turnfestes 1860 in Coburg führt zu dauerhafteren Zusammenschlüssen. 1872 vereinigen sich die Akademischen Turnvereine im Cartell-Verband (CV). Nach dem Austritt des Berliner Vereins, der sich mit losen Sportgemeinschaften begnügen will, wird er 1885 unter der Führung des Leipziger Vereins in den farbentragenden und Bestimmungsmensuren schlagenden „Vertreter-Convent (VC), Kartellverband akademischer Turnvereine auf deutschen Universitäten" umgewandelt. Die nichtfarbentragende Richtung erhält 1883 im Akademischen Turnbund (A.T.B.) einen festen Zusammenschluß. Beide Verbände erzielen auf zahlreichen Turnfesten schöne sportliche Erfolge. Neben sie treten noch verschiedene Sondergruppen der einzelnen Sportarten.
Die christliche Studentenbewegung
Zu einem bedeutenden und mächtigen Faktor im deutschen Korporationsleben erstarken die Verbindungen und Vereine, die sich auf der Basis der Religion zusammenfinden. Der Burschenschaft war mit zunehmender Politisierung das religiöse Element verloren gegangen. Neu, in der gedrückten Atmosphäre der Zeit nach den Karlsbader Beschlüssen mystisch gefärbt, zieht es in den korporativen Raum ein und wird zur bindenden Grundlage, als sich 1830 eine Schar Erlanger Theologiestudenten zu Missions- und Erbauungskränzchen zusammenschließt. Das Gemeinschaftsleben findet in Spaziergängen nach dem Dorfe Uttenreuth seinen Ausdruck, von dem der Verein dann später seinen Namen „Uttenruthia" erhält. Man verwirft alle korporativen Formen, kann aber nicht verhindern, daß mit dem Anwachsen des Kreises auch das Studentische hineingetragen wird und Gegensätze auftreten. Die extremen Flügel werden schließlich ausgeschlossen und der Rest gründet einen Obskurantenverein, der jedes studentische Emblem ablehnt. Die Religion soll das gesamte Vereinsleben wie auch das Leben der einzelnen Mitglieder durchdringen, aber nicht auffällig betont werden. Die einmal angedeutete Entwicklung läßt sich nicht aufhalten. Der Verein übernimmt immer mehr korporative Formen, belegt sogar den Fechtboden, wendet sich aber nach wie vor energisch gegen den Zweikampf. Die nächsten Jahre geben der Uttenruthia einen Charakter, der sie in einer gewissen Weise zur Nachfolgerin der Urburschenschaft werden läßt. Auch an anderen Universitäten bilden sich Bibelkränzchen. Nachdem ein erster Zusammenschluß mit zwei anderen nur kurze Dauer hat, schließt Uttenruthia 1858 einen Vertrag mit Tuiskonia Halle, der sich aber erst 1885 zum Vierbund erweitert, aus dem schließlich 1887 der Schwarzburgbund (S.B.) wird.
Einen eigenen Weg geht das den Anfängen der Uttenruthia verwandte Hallesche Bibelkränzchen. Es nimmt bald straffe Verbindungsform an. Nachdem eine Auseinandersetzung mit Mitgliedern, die das Christentum im Korporationsleben nicht besonders betont wissen wollen, durch deren Ausschließung beendet ist, bildet der Rest 1844 einen neuen Verein und gibt ihm den Namen Wingolf , was nach Klopstock Tempel der Freundschaft bedeutet. Die Wingolf itische Richtung der christlichen Studentenbewegung greift bald auch auf andere Universitäten über. Seit 1846 legen die Vereine Farben an. Sie bilden zunächst einen Gesamtbund, der sich über den unitarischen Gesamt-wingolf 1860 in den föderalistischen Wingolfsbund wandelt. Neben vielen äußeren erwachsen ihm auch bald innere Schwierigkeiten, die vor allen Dingen mit der Frage der Formulierung des Christlichen im Bundesprinzip zusammenhängen. Nur durch den Verzicht auf ein Bundesprinzip in der 1880 beschlossenen Satzung überhaupt kann man eine Spaltung verhüten.
Die katholischen Verbände
Nannten diese Verbindungen sich allgemein christlich, obwohl sie fast rein protestantisch waren, und führten ihr Leben abseits von den anderen Verbänden, so brachte der Katholizismus in konfessioneller Zusammenfassung etwas Neues hervor, über die Vorgeschichte der katholischen Korporationsgründungen, die gemeinsamen Anfänge von CV und KV, ihre ersten Feuerproben und die weitere Geschichte des KV hat Kb AH Popp ausführlich geschrieben.
Ich kann mich deshalb auf die Entwicklung des UV und eine stichwortartige Weiterführung der Geschichte des CV beschränken.
Unleugbar ist der UV der älteste Verband katholischer Studentenkorporationen. Die Wurzeln seines Stammvereins liegen in der Ruhrania, einem Mitglied des Bonner Gesamtvereins von 1847. Die Ruhrania tritt 1848 aus und rekonstituiert sich erst 1850 unter der Führung Hermann Ludger Potthoffs außerhalb der „Union", wie sich der Gesamtverein seit 1849 nennt. 1854 gibt sie sich den Namen „Unitas". Den Anfang des Verbandes bildet die 1855 von Bonn aus erfolgte Gründung der Unitas-Tübingen, die mit ihrer Mutterkorporation einen Gesamtverein bildet. Sie wird zwar 1861 wieder vertagt (bis 1902), aber inzwischen war 1859 als drittes Glied Unitas-Münster hinzugekommen. Der Gesamtverein nimmt anfänglich nur Theologen auf, erst 1887 erfolgt die Umwandlung in einen allgemeinen wissenschaftlichen katholischen Studentenverein. Bis 1900 ist er streng zentralistisch organisiert, dann wird er in den heutigen „Verband der wissenschaftlichen katholischen Studentenvereine" umgebildet. Von den drei katholischen Verbänden weist er wohl die stärkste religiöse Ausrichtung auf.
Für CV und KV kommt nach den ersten stürmischen Jahren eine Zeit ruhiger Entwicklung und stetiger Ausbreitung. 1897 unternimmt der CV einen Schritt, den der KV bereits 1866 getan hat; er breitet sich auf die Technischen Hochschulen aus. Von 1907 an ist er auch auf den Tierärztlichen Hochschulen vertreten. Durch die Einverleibung einiger kleinerer Kartelle wächst er stark an, und ebenfalls 1907 nimmt er auch den österreichischen CV auf.
Der Burschenschaft waren ihre politischen Bestrebungen zum Verhängnis geworden. Eine neue Korporationsart führen sie zu zwar kurzer, aber bedeutender Größe. Es sind die aus den judenfeindlichen Strömungen um 1880 entstandenen
Vereine Deutscher Studenten,
die sich als Hochziel die Gedanken der Bismarckschen Politik und des sozialen Kaisertums zu eigen machen. 1881 feiern sie als Nachahmung des Wartburgfestes ein großes vaterländisches Fest auf dem Kyffhäuser und schließen sich zum Kyffhäuserverband der Vereine Deutscher Studenten zusammen. Es gelingt ihnen, die gesamte Studentenschaft zu zahlreichen nationalen Kundgebungen mitzureißen. Zum Verhängnis wird ihnen die Verquickung der nationalen mit den antisemitischen Bestrebungen, wodurch sie nicht nur die Gründung eigener jüdischer Verbindungen und Kartelle hervorrufen, sondern sich auch die Feindschaft weiter liberaler Kreise zuziehen.
Damit ist die deutsche Korporationsgeschichte bis zu einem Zeitpunkt geführt, an dem ihr ein eisernes Halt entgegengerufen wird.
Der 1. Weltkrieg legt das gesamte korporative Leben still. Zwar hört es nie ganz auf, wird aber nur kümmerlich erhalten. Viele Verbindungshäuser werden dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellt. Alle Verbände richten von ihrem Vermögen und den Spenden ihrer Mitglieder Kriegshilfskassen ein. Großes Verdienst erwerben sich die katholischen durch die Verschickung wertvoller literarischer Liebesgaben.
Zwischen den Kriegen
Aber die großen Verbände, neben die zahlreiche von der Jugendbewegung beeinflußte Neugründungen treten, überstehen die Erschütterungen der Kriegsjahre. Schon bald nach Kriegsende entfalten sie trotz der großen Not eine neue, rege Tätigkeit. Doch sie sehen sich ganz neuen Verhältnissen gegenüber, in den Umwälzungen von 1918 haben auch sie den Boden verloren. Viele sind zu sehr in alter Denkweise befangen und können kein positives Verhältnis zum neuen Staat finden. Andererseits stoßen die Korporationen auf ein tiefes, manchmal sicher begründetes Mißtrauen in der Arbeiterschaft. Die Erkenntnis, daß man sich auf historische Rechte nicht mehr stützen kann, und die Sorge um die Behauptung führen zu den Versuchen, alle korporativen Kräfte zusammenzufassen.
Diese Bestrebungen wirken sich zuerst innerhalb der Verbände aus. Schon 1919 verschmelzen die technischen Landsmannschaften mit der Deutschen Landsmannschaft. Auch die Deutsche Burschenschaft nimmt ihre technischen Bünde des Rüdesheimer Verbandes auf. Die vor dem Krieg zerstrittenen Sängerschaften sammeln sich auch bereits 1919 in einem Bund, der sich seit 1922 Deutsche Sängerschaft (D.S.) nennt. Nur die Sondershäuser Vereine bleiben für sich. Außerdem nehmen fast alle Verbände ihre österreichischen Schwesterverbände auf. Nur im UV zeigt sich eine entgegengesetzte Entwicklung. 1923/24 treten Meinungsverschiedenheiten in der Couleurfrage auf. Die Mehrheit lehnt das Farbentragen ab. Darauf tritt die Minderheit aus und gründet den Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften (RKDB).
Daneben kommt es zu bedeutsamen Zusammenschlüssen von Verbänden. Besonders das Waffenstudenten tum ist um eine Festigung seiner Position bemüht. Corps, Landsmannschaften und Turnerschaften gründen 1919 den Allgemeinen Deutschen Waffenring (A.D.W.). Dagegen schließen sich aber schon 1920 der Kyffhäuser-Verband, der ATB und der Sondershäuser Verband zu einem „Schwarzen Ring" zusammen. Der Einfluß beider Ringe kommt über die ihnen angehörenden Vereine nicht hinaus, da sie nur waffentechnische Fragen und keine allgemeinen Belange einigen. Deshalb verhält sich auch die Deutsche Burschenschaft ablehnend, die ihrerseits 1921 das Erlanger Verbände- und Ehrenabkommen zustande bringt, dem auch UV, CV und KV beitreten. Es soll einen modus vivendi zwischen den Verbänden schaffen, der Vermeidung oder Schlichtung von Streitigkeiten dienen, aber keinesfalls Gegensätze vertuschen. 1922 wird dann eine waffenstudentische Einheitsfront geschaffen. Alle noch abseits stehenden schlagenden Verbände treten dem Waffenring bei, der dafür alle Mitglieder den Erlanger Abkommen zuführt.
Doch alle Bemühungen sind umsonst. Die schlagenden Verbände sind so in völkischen und rassischen Ressentiments befangen, daß sie gar nicht merken, woher dem Korporationsstudenten wirklich Gefahr droht. Als gleich nach der nationalsozialistischen Machtergreifung die Verbände sich erst einmal auf das Führerprinzip umgestellt haben, geht es Schlag auf Schlag, und jetzt vermag weder die unter Führung der Burschenschaft entstandene Hochschulpolitische Arbeitsgemeinschaft noch die aus den Resten des sich seit Anfang November 1934 auflösenden Waffenrings gebildete Gemeinschaft studentischer Verbände, der sich auch CV und KV anschließen, die Selbständigkeit und den Fortbestand der Korporationen zu wahren. Im Oktober 1935 beginnt die Reihe der Selbstauflösungen der Verbände und 1938 fallen die letzten Positionen des deutschen Korporationswesens. Im April schließen sich die waffenstudentischen Altherrenverbände dem NS-Altherrenbund an, und am 26. Juli wird der UV, der sich bis jetzt gehalten hat, als staatsfeindlicher Verband verboten. Das gleiche Schicksal erleiden die Altherrenbünde von CV und KV.
Restauration oder neuer Geist ?
Ist schon eine gerechte und gültige Bewertung der Ereignisse dieser Epoche noch nicht möglich, so ist für den Historiker die Zeit nach dem 2. Weltkrieg erst recht nicht spruchreif. Eines aber läßt sich feststellen: Die großen Verbände haben auch das Chaos von 1945 und die nachfolgenden besatzungsrechtlichen Einschränkungen und Verbote mit nur geringen Veränderungen überstanden. So sind 1951 die ehemalige Deutsche Landsmannschaft und die Turnerschaften des Vertreter-Convents zum Coburger Convent (C.C.) verschmolzen. Ob allerdings die Neugründung der Verbände eine bloße Restauration bedeutet, oder ob sie gewillt sind, durch die Behauptung im Kampfe mit den ihnen aus der Gegenwart erwachsenden Aufgaben sich ihre Daseinsberechtigung neu zu erstreiten, das wird die Zukunft erweisen.
Studentische Trachten, Trink- und Kneipsitten, Studentensprache
Fritz Krabus
Den folgenden Beitrag verdanken wir Kb. Ewald Krabus-Lütgendortmund, der ihn aus hinterlassenen Vorarbeiten seines allzufrüh verstorbenen Bruders, Kb. Fritz Krabus, angefertigt hat. Es ist beabsichtigt, die recht umfangreichen Arbeiten von Studienrat Fritz Krabus über die gleichen Themenkreise in Buchform herauszugeben.
I. Trachten
Zu allen Zeiten, bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, haben die Studenten eine besondere Tracht getragen. Im 12. und 13. Jahrhundert trugen die Scholaren — clerici oder scholares, der Name Student kam erst viel später auf — als Überkleid einen langen bis zu den Knöcheln herabreichenden Mantel, der mit einer Kapuze versehen war. Die Farbe war im allgemeinen schwarz oder dunkel, die Ärmel, oben weit und bequem, liefen nach unten eng zu. Das Untergewand wurde in die enganliegenden Strumpfhosen gesteckt, die man an ihrem oberen Ende mit Bändern am Leibgurt befestigte. Diese Strumpfhosen dienten gleichzeitig als Fußbekleidung, indem man einfach Sohlen unterlegte; seit dem 13. Jahrhundert bediente man sich lederner Halbschuhe. Das Haar trug man im 12. und 13 Jahrhundert bis zur Höhe der Ohren. Als Kopfbedeckung trugen Magister und Scholaren eine Mütze in Form eines umgestülpten Kelches.
Im 14. Jahrhundert verlängerte man den Brustschlitz des Mantels bis zum Gürtel und verknöpfte ihn. Am Gürtel hingen vorn die Ledertasche und ein dolchartiges Messer.
Im 15. Jahrhundert gaben sich Lehrer und Scholaren mit ihrer bisherigen einfachen Tracht nicht mehr zufrieden, sie huldigten der Mode und begeisterten sich für den aus Frankreich gekommenen Tappert, frz. tabard, einen bis zu den Knöcheln, oft auch nur bis zu den Knien reichenden Mantel, der zu beiden Seiten in seiner ganzen Länge aufgeschnitten und häufig in Stoff und Farbe geteilt war; auch die Beinkleider und das Untergewand, Wams genannt, waren in den oft grellen Farben „geteilt"; den breiten und hohen Hut schmückte man mit einer herabhängenden Schleife, Sendelbinde genannt. Im 15. Jahrhundert erscheint der Hut, der im 14. Jahrhundert allgemein getragen wird, auch in der Studentenschaft. Die Füße staken in langspitzigen Schnabelschuhen aus weichem Leder, Samt oder Brokat, ebenfalls verschiedenfarbig; das in den verschiedenen Farben zusammengesetzte Kleidungsstück hieß Mi-Parti. Gegen diese farbige Tracht gingen die Regierung und die Universitäten erfolglos vor. Auch an der inzwischen für Gelehrte und Studenten eingeführten amtlichen Kopfbedeckung, dem Barett, suchten die Studenten Verzierung anzubringen, sie mit Schnüren oder Federn zu schmücken. Das Haar war kurz geschnitten. Die Tracht sollte möglichst unauffällig sein: langer, dunkler Rock, darüber ein Talar. Schnabelschuhe wurden verboten, ebenso farbige und kurze Röcke; über alle Verordnungen setzten sich die Studenten jedoch hinweg und unterwarfen sich lieber den Geld- und Karzerstrafen.
Im 16. Jahrhundert trat der Hang der Studenten, sich nach eigenem Geschmack und nach der Mode zu kleiden, noch stärker in Erscheinung. Der Student machte alle Modeeinfälle und Modetorheiten mit. Die vorgeschriebene Tracht war nach wie vor der lange schwarze Mantel, darunter ein einfaches enganliegendes Wams und enge lange Beinkleider, einfache schwarze Schuhe und ein schwarzes Barett mit breitem Rand, aber ohne Schmuck. Indessen die Studenten begeisterten sich für zylindrische Hüte oder samtene Baretts mit wehenden Federn, den geschlitzten und mit Puffärmeln versehenen, farbenfreudigen engen Rock, für die bis 1520 noch enganliegenden Hosen in geteilten Farben, für die vorn breit abgeschnittenen Schuhe und für den waagerecht getragenen Degen, den sie jetzt statt des bisherigen Dolches ständig mit sich führten. Die engen Beinlinge wurden bald durch die Pluderhosen verdrängt, die nur bis zu den Waden reichten. Universitäts- und Regierungserlasse lehnten zwar die neue Mode entschieden ab, jedoch wiederum ohne Erfolg.
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts diktierte Spanien dem Bürgertum wie auch dem deutschen Studententum eine neue Mode; den Kopf bedeckte wieder ein Barett aus Samt oder Atlas mit weißer Straußenfeder oder ein schmalkrempiger hoher Hut mit Federgesteck. Um den Hals lag die Krause, das Wams mit engen Ärmeln und Spitzenmanschetten war hochgeschlossen und aus Samt oder Seide gefertigt. Der halbkreisförmig zugeschnittene Mantel reichte nur bis zur Hüfte, die seidenen Hosen über die Knie hinweg.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts schlug die Mode völlig um. Statt der steifen spanischen Tracht kam von 1620 ab die weite, farbenfrohe Mode des Barock zum Durchbruch. In der Zeit des 30jährigen Krieges beginnt das Tragen von Trachten und Farben. Die letztgenannten erscheinen zunächst am Degengriff und gehen dann auf Brustschärpen und Kopfbedeckung über. An die Stelle der gestärkten Krause trat ein Leinenkragen mit lockerer Fältelung. Auf dem Kopf saß ein breitkrempiger Schlapphut, der mit Federn malerisch drapiert war. Die Schuhe bekamen einen Absatz; neben den Schuhen trug man auch Wadenstiefel. Im Laufe des 30jährigen Krieges zogen die Studenten die Soldatentracht vor, trugen Degen, Schwert, Dolch und Büchse. Das Haar fiel bis auf die Schultern herab. Die deutsche Schaube wurde von den Franzosen übernommen, abgeändert, erhielt Taschen, Ärmelaufschläge mit Spitzen, statt des Hakens eine lange Knopfreihe und kam in dieser Form zurück nach Deutschland unter dem Namen „justeaucorps", wo sie sich bei Studenten, Bürgern und Soldaten bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts behauptete. Das unter dem Justaucorps getragene Wams, jetzt Weste genannt, wurde unter dem französischen Einfluß gegen Ende des 17. Jahrhunderts verlängert fast bis zur Länge des Überrocks und diesem in seiner Form und Ausstattung angepaßt. Zu dem tressenbesetzten, in der Taille enganliegenden Justaucorps paßten natürlich keine Pumphosen; man trug dazu enge Kniehosen, an den Unterschenkeln farbige Kniestrümpfe. Um die Jahrhundertwende übernahm man von Frankreich den Dreispitz, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts vom Zweispitz abgelöst wurde. Auch die künstliche Frisur, die lang herabhängende Lockenperücke, wurde von den Studenten übernommen. Zur vollständigen Ausrüstung gehörte noch die ellenlange Tonpfeife.
Im 18. Jahrhundert gehören zur Studententracht der Dreispitz, der Justaucorps in leuchtenden Farben mit Spitzenmanschetten, andersfarbigen Ärmelaufschlägen und verzierten Taschen; unter dem Justaucorps der einige Zentimeter kürzere Leibrock, die Weste, dazu Kniehosen und farbige Strümpfe. An den Füßen Schnallenschuhe oder hohe Stiefel mit mächtigen Sporen; die halblange Tonpfeife wurde gegen Ende des Jahrhunderts durch eine doppelt lange Holzpfeife mit Porzellankopf verdrängt. Degen und dünne Spazierstöckchen vervollständigten den Anzug. Rock und Weste waren vom Hals bis zur Brust offen gelassen, um das Halstuch mit der Brustkrause sehen zu lassen. Auf seiner Bude zog der Student statt Rock und Weste einen buntgestreiften Schlafrock an. Seit Beginn der Rokokozeit trat an die Stelle der Allongefrisur die leichtgelockte Perücke, die am Hinterkopf in einem Zopf zusammengefaßt wurde. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts gab es zwei nach Tracht und Auftreten verschiedene Studententypen: der Renommist und der Stutzer; der Letztgenannte kleidete sich nach der neuesten Mode und trug Frack und kurze Weste, legte Wert auf feines Benehmen, suchte gesellschaftlichen Verkehr mit vornehmen Kreisen und drückte sich in gewählter deutscher Sprache aus. Den zierlichen Dreispitz nahm er in die Hand und ging barhäuptig, um die wunderbare Haarfrisur zu zeigen. Den Hals umschlang ein schwarzes, am Kinn zu einer Schleife gebundenes Seidenband. Der Justaucorps war mit Stickereien verziert, die bis zur Mitte der Oberschenkel reichende blaue Weste war mit Gold und Silber durchwirkt; zu der Kniehose aus schwarzer Seide paßten die hellen Seidenstrümpfe und die zierlichen schwarzen Schuhe. Beim Reiten trug der Stutzer weichlederne, enganliegende lange Hosen, dazu Wadenstrümpfe mit silbernen Sporen. An der linken Seite hing der schmale Galanteriedegen, mit einer weißen Schleife geschmückt, während an der Uhr zumeist ein goldenes Band baumelte. Der Renommist dagegen hatte Gefallen an einem forschen, lärmenden Auftreten und an Kraftausdrücken, trug Strähnenhaar mit dem nüchternen Zopf, einen kurzen, wollenen Oberrock mit Tressen und halblangen Ärmeln, eine noch kürzere schmucklose meist gelbe Weste, dicke hirschlederne Stulpenhandschuhe und ebensolche Beinkleider, Kanonenstiefel mit mächtigen Sporen, einen großen Dreispitz mit Federn, einen schweren Raufsäbel, dazu quer über Brust und Rücken wie eine Schärpe die Hetzpeitsche.
Zur Studententracht des 18. Jahrhunderts gehören auch die farbigen Abzeichen, durch die der Student als zu einer bestimmten Studentenverbindung gehörig, Landsmannschaft oder Orden, sich zu erkennen geben wollte; diese Abzeichen trug er an der Kopfbedeckung, am Degen, an der Uhr, am Stock und an der Pfeife. Während und nach dem Siebenjährigen Kriege hatte die Studentenschaft eine große Vorliebe für die militärische Kleidung an den Tag gelegt, aber unter dem Einfluß der Französischen Revolution gab sie der bürgerlichen Tracht wieder den Vorzug, nämlich einem hohen Filzhut mit breiter Krempe, langen gestreiften Hosen, deren Träger Sansculotte hießen, da die bisher modischen Kniehosen culottes genannt worden waren.
Seit Mitte des 18. Jahrhunderts regnete es an den einzelnen Universitäten Verbote gegen das Degentragen; statt des Degens nehmen die Studenten dann den Knotenstock. Gegen Ende des Jahrhunderts verschwinden Degen, Perücke und Dreispitz. Es setzen sich lange Hose und Filzhut durch; die lange Pfeife wandert mit in die Vorlesung; ja, mitunter geht man sogar im Schlafrock dorthin. Nur die Senioren hatten fast immer ihren Wichs an: Lederhelm mit Federbusch oder schulterbreiter Dreimaster, reichgestickter Uniformrock mit Achselstücken, Lederhosen und mächtige Stiefel.
Französischem Einfluß ist es zuzuschreiben, wenn die Studenten im ersten Dezennium des 19. Jahrhunderts dazu übergingen, über ihrer Weste von der rechten Schulter zur linken Hüfte ein Band zu schlingen, das die Farben des Bundes hatte. Neben dem schwarzen Samtbarett mit Straußenfeder und dem aus dem bürgerlichen Leben vollständig verschwundenen Dreispitz mit Federbusch kamen jetzt auch bunte Mützen und Stürmer auf. Die Chargierten, bei festlichen Anlässen auch die übrigen Verbindungsmitglieder, trugen nun auch Schärpen in den Korporationsfarben, uniformähnliche Röcke mit andersfarbigen Kragen, Aufschlägen und Achselstücken dazu, wie schon vor 1800, weißlederne Hosen, lange Stiefel mit Sporen. In manchen Verbindungen zog man auch lange Hosen in leuchtenden Farben zum farbigen Rock und zur goldbetreßten Weste an. Diese Tracht, von den Universitäten zunächst als zu kostspielig abgelehnt, setzte sich gleichwohl durch und hat sich, nachdem von Süddeutschland her das Cerevis gleichberechtigt neben das federgeschmückte Barett und an die Stelle des bunten Fracks die Pekesche getreten war, bis auf den heutigen Tag als Vollwichs der Chargierten gehalten.
Während und kurz nach den Freiheitskriegen wurde der Gedanke, eine deutsche Nationaltracht einzuführen, von der Studentenschaft begeistert aufgegriffen. Besonders die 1815 gegründeten Burschenschaften entschieden sich für die altdeutsche Kleidung und hielten trotz behördlicher Verbote bis in die 30er Jahre daran fest. Hauptmerkmale der altdeutschen Tracht waren die lange, halbweite Hose aus Tuch oder Leinen, schwarze Schuhe mit und ohne Sporen, ein über die Knie hinwegreichender Rock, der über der Brust bis zum Hals völlig zugeknöpft war und mit einem Stehkragen abschloß, ein schwarzes Barett oder eine in den Farben Schwarz-Rot-Gold gehaltene Schirmmütze, langes Haupthaar und ein Schnauz- und Backenbart.
Bei einem Teil der Corpsstudenten erfreute sich in den 20er und 30er Jahren die altfränkische Tracht einiger Beliebtheit. Zur altfränkischen Tracht gehörten lange weite Hose oder engere weiße Hose, dazu lange Stiefel mit Sporen, ein auffallend weiter Mantel und langer Rock, dessen Ärmel unten einen enganliegenden Umschlag hatten; die Farbe des Rockes war zumeist schwarz oder dunkelblau. Im allgemeinen jedoch nahm die Studentenschaft die bürgerliche Tracht jener Zeit an, die von der englischen Mode beherrscht wurde. Bis etwa 1830 wurden dunkle Farben bevorzugt, die Hosen waren eng, der Rock, weit und lang, wurde jedoch fast nur als Hausanzug getragen, während der aus dem Justaucorps durch Fortlassen der vorderen Schöße entstandene Frack das übliche Gewand sowohl für Gesellschaft wie auch für die Straße war. Dunkle Farben, guter Schnitt und die Art des Tragens sind entscheidend; das Beinkleid bleibt eng und lang, wiewohl man an den fürstlichen Höfen noch eine Zeitlang an der Kniehose festhält. In den 30er und 40er Jahren ging man wieder zu farbigen Stoffen über, selbst für den Frack wählte man lebhafte Farben, Grün oder Hellblau, und trug dazu vielleicht eine violette Weste und weiße Hose. Im Ausschnitt der Weste erblickte man das glatte oder gefaltete Jabot, das oben mit der breiten Halsbinde abschloß, aus welcher die langen Spitzen des Hemdkragens als „Vatermörder" herausragten. Mäntel zum Schutz gegen Schnee und Regen gab es zwar damals schon, wurden von den Studenten jedoch abgelehnt, die sich lieber naßregnen ließen. Ihre Kleider konnten dann im Colleg langsam wieder trocken werden.
In den 50er Jahren werden die mit einem Steg versehenen Beinkleider weiter. Der Frack erhält endgültig die schwarze Farbe, tritt jedoch auf der Straße mehr und mehr zurück vor dem bis zum Oberschenkel reichenden Schoßrock und dem Jackett, das seit 1867 auch zweireihig getragen wird. Hatte man bis 1800 Rock, Weste und Hose in verschiedenen Farben, die zuletzt genannten meist heller als der Rock, getragen, so ging man jetzt dazu über, für den ganzen Anzug denselben Stoff in gleicher Farbe zu nehmen; an Stelle des Vatermörders mit dem Halstuch waren in den 50er Jahren der gestärkte Leinenkragen und die schmale dunkle Krawatte, Fliege genannt, getreten. Soweit der Student nicht die bunte Mütze aufsetzte, trug er den weichen grauen und meist breitkrempigen Filzhut, der seit 1840 den hohen Zylinderhut aus dem Alltagsleben verdrängte. Der Zylinder blieb seitdem die Kopfbedeckung für Festlichkeiten. Neben dem Filzhut trug man auch wohl den steifen halbrunden Hut, Melone oder Bombe genannt, der um 1850 von England her in Mode gebracht wurde. Der Anzug bleibt nun im großen und ganzen unverändert mit Ausnahme der Weste: sie ist das einzige Kleidungsstück, in dem die Herrenwelt einen individuellen Geschmack nach Stoff und Farbe entwickeln kann, in der Form bleibt sie unverändert, nur an der Machart vermag die Mode geringfügige Änderungen vorzunehmen. Mal werden Hosen und Röcke weiter, mal enger, mal ist der Ausschnitt größer, mal ist er kleiner. Nach dem zweiten Weltkrieg kam wieder mehr Abwechslung in die Herrenkleidung. Hose und Rock haben verschiedene, wenn auch im Farbton übereinstimmende Farben; diese ursprünglich wohl aus der Not geborene Mode hat sich bis heute erhalten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam die Bügelfalte und zu Anfang unseres Jahrhunderts der Umschlag an der Hose auf. Der Student unterschied sich in seiner Zivilkleidung in keiner Beziehung mehr von den anderen Bevölkerungskreisen, nur daß die Mitglieder farbentragender Korporationen am Hochschulort Mütze und Brustband in den Farben ihres Bundes anlegten und anlegen. Von den früheren Studententrachten ist bei einigen Korporationen der Kneiprock übriggeblieben; Pfeifen, Degen, Kanonenstiefel mit Sporen sind verschwunden. Der Wichs jedoch ist unverändert geblieben; allgemein noch findet der Zirkel Verwendung, desgleichen noch Rocknadel und Zipfel.
Trinksitten
Zu den studentischen Bräuchen, die bisher alle Stürme und Modernisierungen überdauert haben, gehören besonders die Trinksitten.
Schon bei Griechen und Römern, ja selbst bei den alten Germanen gab es bei den Gastmählern bestimmte Regeln und Gewohnheiten, nach denen man einander zu- und nachtrank. Die deutschen Trinksitten kamen aber erst zur vollen Blüte im 16., 17. und 18. Jhrh. durch den deutschen Adel und vor allem durch die deutschen Studenten. Im 16. Jhrh. bereits war der Duztrunk genau geregelt. Auch der Ausdruck „Schmollis" dafür ist damals ebenso bekannt und geläufig wie die andere Bezeichnung „Fiduzit". Die Duzbrüderschaft stand freilich nicht im Rufe großer Beständigkeit. Man leerte den Humpen, reichte sich die Hand und nach Namensnennung gelobte man sich in feierlichen Sprüchen oder Versen Brudertreue und gegenseitigen Beistand. Auch die Sitte oder Unsitte des „Restwegtrinkens" übte man; man prägte dafür die Ausdrücke „florikos" bzw. „haustikos". Beim Kommando „Florikos" umschloß man mit den Lippen den Humpenrand und kippte den Inhalt mit einem Guß in die Kehle, worauf sich infolge des Gegenstromes des Atems an den Lippen kleine Luftbläschen — „Blumen" — bildeten. Haustikos nannte man den durch Übung erzielten Gewalttrunk, bei dem der ganze Inhalt des Trinkgefäßes ohne Atemzug auf einmal geschluckt, besser gesagt durch die offengehaltene Speiseröhre geschüttet wurde.
Hauptgetränk war das Bier. Im 18. Jhrh. spielte auch der Kaffee, daneben besonders in Süddeutschland der Wein, in Ostdeutschland der Schnaps eine Rolle. Die größeren Trinkgelage wurden im 16. und 17. Jhrh. als „Schmause", im 18. Jhrh. als „Hospize" bezeichnet. Gegen Ende des 18. Jhrh. kam dann das Wort „Kneipe" in Brauch, ein Wort, mit dem sowohl ein Wirtshaus wie ein studentisches Trinkgelage benannt wurde.
Die Schmause bzw. Hospize fanden in der Wohnung eines Studenten statt; sie begannen mit allgemeinem Pfeifenrauchen, wobei die Füchse mit dem Fidibus die Pfeifen in Brand setzten. Um die Mitte des 17. Jhrh. übernahmen die deutschen Studenten von ihren französischen Kommilitonen die Sitte des Rauchens. Wurde nicht genügend Dampf erzeugt, so erscholl das Kommando „Generaldampf!" und alle mußten aus Leibes- und Lungenkräften ziehen und qualmen, vielleicht gar „Holländer machen", d. h. ohne Unterlaß solange rauchen, bis die irdenen Pfeifen völlig leer waren. Das oben erwähnte Wort „Kommilitone" für Mitstudent ist seit dem 16. Jhrh. gebräuchlich. Nach dem Pfeifenrauchen folgte ein kleiner Schmaus und anschließend das eigentliche Trinkgelage. Vor Mitternacht durfte ein Hospiz, das unter Leitung eines Präses stand, dessen Anordnungen unbedingt Folge geleistet werden mußte, nicht beendet werden. Im 18. Jhrh. arteten diese Hospize zu mörderischen Saufgelagen aus. — Zum Zeichen allgemeiner Verbrüderung und gegenseitiger Treue wurden, wohl um damit zu bekunden „bis in den Tod", die Hüte durchstoßen und auf eine Degenklinge geschoben. Da außer auf die Brüderschaft fast regelmäßig auch auf den Landesfürsten angestoßen und anschließend daran die Hüte aufgespießt wurden, so bürgerte sich für diese Trinksitte der Ausdruck „Landesvater" ein. — Seit 1790 wurde der Ausdruck Hospiz völlig von dem französischen Wort „Kommers" verdrängt. — Ein Bierkomment, der bereits im 18. Jhrh. voll ausgebildet war, wurde 1815 in Heidelberg gedruckt und immer weiter ausgebaut; er regelte das Vor- und Nachtrinken, gab genaue Anweisungen über den Bierverruf (BV) und das Herauspauken aus demselben sowie über das Austragen von Bierskandalen. Auf das Jahr 1368 geht bereits ein Reglement (Komment) zurück. Im Jahre 1615 erschien das „jus potandi": haustikos, florikos, auf den Duz trinken oder eines auf Bruderschaft bringen; man trinkt „continue". Die Folgen der heftigen, übermäßigen Zecherei findet man auf vielen Zeichnungen von Studentenstammbüchem drastisch dargestellt. Als nach dem 30jährigen Krieg die studentischen Formen einen allzu rauhen Zug annahmen, übernahmen die deutschen Studenten ihren „modus vivendi", ihre Purschenraison, auch Purschen-manier oder Studentenmaximen genannt, durch den das regel- und maßlose Trinken in geregelte Bahnen gelenkt werden sollte. Gegen Ende des 18. Jhrh. umfaßt der Comment auch die Fecht-, Anstands- und Kleiderregeln.
Seit langer Zeit gilt als höchste studentische Ehrung beim Kommers der sogenannte Salamander. Der Wortsinn ist noch nicht einwandfrei gedeutet; die Sitte, so lautet eine Erklärung, sei auf studentischen Bursen im 16. Jhrh. geübt worden und stehe im Zusammenhang mit dem italienischen Wort „salamecho", das aus dem arabischen Gruß „salem aleikum" verkürzt worden sei. Deutsche Studenten hätten die Sitte und den Namen auf deutsche Universitäten übertragen und das unverstandene Wort umgeformt und umgedeutet. Geht man von dem Wort „Salamander" aus und nimmt man es als ursprünglich an, gelangt man zu einer anderen Erklärung: nach dem Glauben der Alten und nach verbreitetem Aberglauben des Mittelalters lebte der Salamander im Feuer und galt als Geist des Feuers; er wurde für ein Zauberwesen gehalten, und dem beschwörenden Wort „Salamander!" wurden Zauberkräfte beigemessen. Wenn man also vor dem Trunk das Zauberwort „Salamander" aussprach, sollte das wohl ein bekräftigender Wunsch, ein verstärktes „Prosit" sein. Die besonders innige Art des Wunsches wurde dann durch den feierlichen Trinkritus noch eigens unterstrichen. Vielleicht gibt auch folgende Überlegung eine Erklärung; Als diese Sitte aufkam, wurde der Salamander zunächst nur mit angezündetem Branntwein gerieben; das Hinunterschlucken dieses brennenden Stoffes versengte dem Trinkenden die Kehle ebensowenig, wie der Salamander durch Feuer versehrt wurde, so geht die Sage. Reiben wird hier im ursprünglichen Sinne gebraucht, ah. wriban = drehend bewegen. Der Salamander wurde nämlich anfänglich mit angezündetem Branntwein gerieben, in Breslau und Halle mit Schnaps. Seit Anfang des 19. Jhrh. kam das Salamanderreiben beim Kommers in Brauch. Im Glauben an die Feuerbeständigkeit des Salamanders soll auch die Freundschaft die Feuerprobe bestehen.
Noch bis in die 20er Jahre unseres Jahrhunderts war der Fuchsritt üblich, bei dem die Füchse rittlings auf Stühlen sitzend unter dem Lied: „Was kommt dort von der Höh'?" durch den Kneipraum ritten, angeführt vom Fuchsmajor. Im Anschluß an den Fuchsritt fand früher ein Fuchsbrennen statt. Die Burschen suchten mit einem talg- oder ölgetränkten Fidibus in den Händen den durch ihre Reihen laufenden Füchsen die Haare zu sengen. Heute erinnert an diese Prozedur beim Fuchsbrennen noch der Name Brandfuchs, weil vor dem Brandungsexamen den bis dahin krassen Füchsen das Gesicht mit brennendem Fidibus oder angebranntem Korken geschwärzt wurde, was als abhärtende Prüfung angesehen wurde. Für das Wort Fidibus gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten:
a) vielleicht stammt das Wort vom lateinischen Adjektiv fidus = treu, d. h. immer zur Hand, immer zur Stelle, mit scherzhafter Endung ibus, wie sie bei den Studenten beliebt war.
b) Zu den wegen des Rauchverbotes geheimgehaltenen Hospizen des 17. Jhrh. seien im gewissen Sinne chiffrierte Einladungen ergangen, deren formelhafte Einleitung etwa gelautet habe: Fid(elibus) (fratr) ibus s(alutem) d(icit) N. N. h(ospes) hodie hora VIII .. .". Dieses Einladungsschreiben sei dann zusammengefaltet als Fidibus verwendet worden.
c) Die größte Wahrscheinlichkeit scheint die Erklärung für sich zu haben, die der bedeutende Textkritiker und Germanist Moritz Haupt gibt: Ein Student habe beim Pfeifenanzünden von Horaz Ode I, 36 zitiert „Et ture et fidibus iuvat placare deos ..." „Weihrauch bring ich und Saitenspiel froh zum Dank für die Götter." Mit ture habe der Student auf den Tabakrauch angespielt. Und da zum Rauchen der Papierstreifen zum Anzünden genau so gehöre wie bei einem Dankfest zur Begrüßung nach langer Abwesenheit das Saitenspiel zum Weihrauch gehört, so sei mit fidibus in diesem Falle scherzhaft auf den papierenen Zündstreifen hingedeutet worden.
Da die Kneipen sich in ihrem Ablauf mehr und mehr den feierlichen Kommersen anglichen, führte man außerdem zwanglosere Exkneipen ein. Seit Anfang des 19. Jhrh. kamen auf den Kneipen die sogenannten Biermimiken in Schwang, zumeist blutrünstige Balladen; aber auch an größere Theateraufführungen machten sich die Korporationen heran. 1866 führte beispielsweise Germania Münster sophokleische Werke (Philokete, König Ödipus, Antigone) auf und erzielte damit ungeahnte Erfolge und begeisterte Anerkennung bei höchsten Behörden; auch größere Lustspiele und selbstverfaßte Travestien gelangten zur Aufführung, darunter zwei große Travestien von dem Germanisten Professor Dr. Julius Schwering, AH der Germania. Ähnliche Theateraufführungen waren vom Corps Silesia Breslau 1851/52 veranstaltet worden, ebenso vom Leipziger akademischen Gesangverein Paulus seit 1864. Seit 1840 kam der Brauch auf, daß bei den Kneipen die einzelnen Teilnehmer nur mit ihren Biernamen angeredet wurden. Dieser Brauch ist zu Zeiten sehr stark gewesen, dann flaute er mal wieder ab, um urplötzlich wieder aufzuleben; er hat sich mancherorts bis in die neueste Zeit gehalten.
Studentensprache (stylus bursicus)
Das deutsche Studententum hat durch die Entwicklung einer eigenen Standessprache den deutschen Sprachschatz außerordentlich bereichert. Kerndeutsche Wörter wurden vielfach einem Bedeutungswandel unterworfen, in Vergessenheit geratene oder mundartliche Wörter wurden in die Umgangssprache geholt. Da es naheliegt, daß junge Leute, die sich samt und sonders mit dem Studium fremder Sprachen befaßt hatten oder befaßten und auf ihre Sprachkenntnisse nicht wenig stolz waren, oftmals fremdsprachige „Brocken" in ihren Wortschatz aufnahmen, so ist die Zahl der von den deutschen Studenten in das deutsche Sprachgut eingeschleusten Lehn- und Fremdwörter außerordentlich groß; lateinische, italienische, französische, griechische, auch rotwelsche Ausdrücke wurden als Fremd- oder zumeist als Lehnwörter dem deutschen Sprachgut einverleibt, wobei die letztgenannten oftmals so sehr umgeformt wurden, daß sie deutschem Erbgut nicht nur zum Verwechseln ähnlich, sondern sogar zum Verwechseln gleich geworden sind.
Aus der großen Fülle der Wörter, die von den deutschen Studenten in die sogenannte Burschensprache übernommen bzw. von da in das allgemeine deutsche Sprachgut eingeführt wurden, seien folgende herausgegriffen:
„abgebrannt" (18. Jahrhundert) = ohne Geld, eigentlich einer, der durch Brand alles verloren hat; im 30jährigen Krieg wurde dieser Ausdruck gebraucht, um damit einen mittellosen, völlig armen Teufel zu bezeichnen; im 18. Jhrh. übernahmen die Studenten dieses Wort und sorgten für seine Verbreitung; Goethe machte es hoffähig (Dichtung und Wahrheit, 8. Buch).
„Backfisch" (16. Jahrhundert) = junges Mädchen, eigentlich kleiner, zum Backen geeigneter Fisch; vielleicht aber auch an Baccalaureus anklingend, zumal mit dem Wort zunächst die jungen, unfertigen Studenten bezeichnet wurden; in der Bedeutung „halbwüchsige Mädchen" ist der Ausdruck auch in die Neuniederländische Sprache — backvisch — und ins Dänische — baklisk — eingegangen; Backfischkasten neueren Datums ist scherzhafte Bezeichnung für Mädchenpensionat.
Becher, griechisch KYMB, mlat. bicarium Trinkgefäß; gr. bikos Gefäß für Wein.
„bemoost" (18. Jahrhundert) = altes Semester, wie ein altes Mauerwerk mit Moos überzogen ist; es findet sich sogar eine Erklärung für diesen bildlichen Ausdruck: „Es wachst iehms Mies aufm Mantel." Dies sagt man von alten Studenten.
„berappen", man könnte an die Rappenmünze denken, die im alten Rappenmünzland, also in der Schweiz, im Elsaß, im Badener- und Schwabenland üblich war (1403—1584); da aber das Wort berappen oder birappen erst in viel späterer Zeit bekannt wird (1848) und mundartlich, wenn es von Rappen käme, „brappe" heißen müßte, bleibt wohl nur die Erklärung: 2. Mos. 21, 19: Wer einen im Streit verletzt, rappo jerappe, bezahle die Arztkosten.
„blamieren" = bloßstellen, seit dem 17. Jahrhundert gebräuchlich, aus dem frz.
„blamer" = tadeln. Dazu blamabel und Blamage.
„blechen" (18. Jahrhundert) = bezahlen, Blech gehört wie das Adjektiv bleich zur Wortwurzel blik = etwas Blinkendes, wie eine blanke Münze.
„blümerant" 17. s. = schwindlig, entstellt aus bleumourant, sterbensblau, leichenfarben, blaßblau; die blaßblaue Farbe beherrschte im 17. s. so sehr die Mode, daß man sich daran leid sah, so daß einem bei ihrem Anblick blümerant vor den Augen wurde.
„Brandbrief", 17. s. = dringender Brief um Geld; ursprünglich zu Beginn des 15. s. ein Fehdebrief, in dem mit Brand gedroht wurde, dann amtliche Bescheinigung für jemanden, der Haus und Hof durch Brand verloren hatte und mit dieser Bescheinigung Mitleid erregte und betteln ging, dann vom 17. s. ab von den Studenten zur Bezeichnung eines dringlichen Mahnbriefes übernommen.
„brummen", um 1800 = gefangen sitzen, eigentlich brummig, unwillig sein.
„büffeln", 16 s. = angestrengt arbeiten, das Wort büffeln von lat. bubalus abgeleitet, bedeutet Gazelle, wurde dann aber wohl wegen des Anklanges an bos = Rind auf Büffel, italienisch bufalo übertragen.
„ça donc" wohlan denn! Beim Zutrunk seit dem 17. s. gebräuchlich.
„burschikos" = nach Burschen Art, zusammengesetzt mit der griechischen Adverbialendung os, seit 1720 studentensprachlich beliebte Zwitterbildung.
„deichseln" = mit einer schwierigen Sache fertig werden, entweder von Deichsel = Zugstange am Wagen, also mit der Deichsel einen Wagen, besonders rückwärts, durch eine enge Durchfahrt, wie ein Tor oder eine Gasse, lenken (so Kluge); wahrscheinlicher aber deichseln soviel wie etwas fertig bringen, etwas mit der Deichsel, dem Breitbeil, bearbeiten.
„durchbrennen" — brennen, daß ein Loch entsteht, heimlich sich davon machen, auskratzen.
„durchlallen", 17. s. = Prüfung nicht bestehen, eigentlich durch den mit einem schwachen Boden versehenen Korb fallen; daher sagt man noch heute „jemandem einen Korb geben", d. h. ihn abweisen. Von den Studenten wurde dieses Bild auf das negative Prüfungsergebnis übertragen = nlt. studentische Bildung corbissare = durchs Examen fallen.
„fidel" = treu, zuverlässig, auch im Frohsinn, dann lustig.
„Fink", Ende des 18. s. = nicht inkorporierter Student, sonst auch wohl Wilder, Obskurant, Kamel oder Mucker genannt; ursprünglich bezeichnete das Wort ganz allgemein einen lustigen, ungebunden lebenden jungen Mann, der, wie Schiller in Wallensteins Lager, 7. Auftritt, den jungen Rekruten singen läßt, „frei wie der Fink" ist; schon im 15. s. hieß der Karzer im Studentenmund scherzhaft Finkenbauer, weil dort die lustigen Studenten, die munteren Finken, wie in einem Vogelkäfig gefangengehalten wurden; die heutige Bedeutung Fink = außerhalb einer Korporation, für sich lebender Student, taucht zum ersten Male in Halle auf, wo im Jahre 1790 von der Clique obskurer Finken gesprochen wird; noch eindeutiger zitiert ein Senatsbeschluß der Universität Jena aus dem Jahre 1822 „die sogenannten Wilden oder Finken".
„Hott", 18. s. zu fließen, oben auf dem Wasser schwimmend, leicht, leichtlebig, lebenslustig, gewandt.
„Florett", italienisch fioretto = Stoßfechtel, vorn mit Bouton = Knopf, Blüte, und hinten mit Stichblatt versehen.
„keilen" = erste Semester werben. Schon in Athen keilten sich die einzelnen Studentenkorporationen vor allem die von auswärts in Piräus ankommenden Neulinge weg und gerieten deswegen oft in eine heftige Keilerei.
„Knote", 18. s. = Handwerksbursche, Nichtstudent, stammt aus dem ah. genot(e) gleich Genosse, Gefährte, Geselle.
„knüll(e)", betrunken, von knüllen = knittern, knautschen; knüll also eigentlich zerknittert.
„Karzer", 14. s. = Studentengefängnis, dasselbe Wort wie Kerker, das aber zu einer viel früheren Zeit vom lat. carcer übernommen worden war.
„Kartell", 18./19. s. = schriftliche Aufforderung zum Zweikampf, daher auch Kartellträger, dann Vereinbarung, Verband, Zusammenschluß; italienisch cartello aus lat. chartula = Urkunde, Kampfordnung beim Turnier.
„Kater" = Katzenjammer = griechisch Katarrh; durch Volksetymologie aus dem seit dem 16. s. gebrauchten griechischen Wort = Flußfieber entstanden, hat nichts mit dem Wort Katze, Kater zu tun.
„Kies", als Bezeichnung für Geld, rotwelsch, geht zurück auf arabischhebräisch kis = Beutel; seit Anfang des 19. s. gebräuchlich.
„Kohl", 19. s. = Unsinn, kohlen = albernes Zeug reden, schwindeln, vom hebr. gol = Gerücht.
„Komitat". Schon zu Anfang des 17. s. gab es für abziehende ältere Studenten das ehrenvolle Comitat; der Abziehende saß im vierspännigen Wagen, vor dem ein uniformierter Verbindungsbruder als Zugführer ritt, hinter dem Wagen die übrigen Bundesbrüder zu Wagen oder zu Roß und am Schluß wieder ein uniformierter Zugbeschließer. Der Scheidende wurde zumindest bis zum nächsten Dorf begleitet. In Marburg ist ein Comitat schon 1614 bezeugt. Seit der Mitte des 19. s., als man allgemein mit der Eisenbahn fuhr, wurde der abziehende Bursch zum Bahnhof geleitet, wo er unter Absingen des Liedes „Bemooster Bursche zieh' ich aus..." verabschiedet wurde.
„Kontrahage" = Herausforderung, Vertrag.
„Kontrafechten" = fechten mit Gegner.
„Kontrahent" = Gegner beim Zweikampf.
„kontrahieren" = zum Zweikampf fordern.
„kraß" von crassus, dick, hart, grob.
„kreuzfidel" = ganz lustig, wie kreuzunglücklich = ganz unglücklich, Steigerung unter Hinweis auf das Leiden des Gekreuzigten.
„koramieren" = unter vier Augen zurechtweisen, fordern lassen. coram = von Angesicht zu Angesicht; vgl. auch das heute noch allgemein gebräuchliche coram publico = öffentlich.
„Manichäer", oder Philister, wahrscheinlich nichts weiter als Mahnichäer mit einem Seitenblick auf die Sekte der Manichäer.
„Monatswechsel", zuerst Studentenwechsel, so alt wie die im 12. s. entstandene Einrichtung des Wechselgeschäftes. Dem Studenten, der sich in Italien aufhielt, wurde der ihm von zu Hause zugesandte Betrag nicht nur ausgezahlt, sondern auch gleich gewechselt.
„Moos", rotwelsch, von jüdisch maos, hebr. maoth, in der Form „mess" bereits im 15. s. bekannt, in der Gaunersprache seit Mitte des 18. s. „Moos haben" wurde in der Studentensprache scherzhaft erweitert zu „Moses und die Propheten haben", veranlaßt durch die Stelle bei Lukas 16, 29.
„Moneten" von moneta = Münze.
„Nassauern". Zu den Vergünstigungen der an der Universität Göttingen Studierenden des ehemaligen Herzogtums Nassau gehörten zwölf Freitische. Erschien einer von den zwölf Stipendiaten nicht zeitig am Freitisch, so hätte, wie man sagt, ein anderer Nassauer diese Gelegenheit ausgenutzt. Solche Nutznießer nannte man Nassauer. Auch heute noch allgemein gebraucht für Schmarotzer, die auf anderer Leute Kosten leben. Vielleicht hängt das Wort aber auch zusammen mit dem rotwelschen „nass" = ohne Geld; so heißt es in Thomas Murners Narrenbeschwörung: „Man findet jetzund wol nasse Knaben, die weder müntz noch gülden haben."
„patent", Anfang des 19. s. = sauber, nett, brauchbar; patens littera = offener Brief, Landesherrliche Urkunde, Urkunde einer Anstellung, Zeugnis für Güte; 1813 bezeichneten Göttinger Studenten aufkommende seidene Strümpfe als „höchst patent".
„pauken", 17. s. = einbläuen, unterrichten, duellieren, von mh. puken = darauflosschlagen.
„Pfiffikus", 18. s. = Schlaumeier, burschensprachliches Substantiv zum Adjektiv pfiffig, abgeleitet von pfeifen; der Vogelfänger pfeift, um die Vögel anzulocken, daher Pfiff — auch heute noch — oft gleichbedeutend mit „Kniff, Kunstgriff".
Quellenangabe
Bühler, Joh., Die Kultur des Mittelalters. Stuttgart 1948.
Burdach, K., Studentensprache und Studentenlied in Halle vor 100 Jahren. Halle 1894.
Bruchmüller, W., Der Leipziger Student 1409—1909. Leipzig 1909.
Fabricius, W., Die Studentenorden des 18. Jahrhunderts. Jena 1891.
Goethe, Faust.
Heer, Marburger Studentenleben 1527—1927.
Hottenroth, Friedr., Deutsche Volkstrachten. 1915.
Keil, Robert und Richard, Die deutschen Stammbücher des 16. bis 19. Jahrhunderts. Berlin 1893.
Kindleben, Studenten-Lexikon. Halle 1781.
Kluge, Deutsche Studentensprache. Straßburg 1895.
Köhler, Bruno, Allgemeine Trachtenkunde. Leipzig 1932.
Kohlfeldt und Ahrens, Ein Rostocker Studenten-Stammbuch von 1736/37. Rostock 1919.
König, Geschichte der Studentenschaft und des studentischen Korporationswesens auf der Universität Halle. Halle 1894.
Kortum, K. A., Jobsiade.
Paulsen, Wesen und geschichtliche Entwicklung der deutschen Universitäten (im Lexis: Die deutschen Universitäten. 1893.)
Schulze-Szymank, Das deutsche Studententum. München 1931.
Zachariae, J. F., Der Renommist. Ein scherzhaftes Heldengedicht.
Das Studentenlied im KV
Rolf Meier - Wagner
Die Bindung des Studenten an die Musik ist uralt. Schon das Mittelalter kannte Studentenlieder und Studentenmusik in unserem heutigen Sinne. Es gab Scholaren, Studenten, Vaganten, die ihr Wissensdrang und ihr Wandertrieb die berühmtesten Universitäten aufsuchen ließ. Wenn sie schon auf der Universität zum Teil recht locker gelebt haben, so gerieten sie erst auf ihrer Wanderschaft ins Bummelantenleben, in gefährliche Nachbarschaft der Spielleute, Gaukler, Gumpel-männer und Mimen. Solchen Bohemepoeten mag man wohl die massiven Sauf- und Freßlieder zutrauen, wie sie uns in der wichtigsten und schönsten Sammlung von Carmina Burana aus dem 13. Jahrhundert überliefert sind. Es ist die Poesie der fahrenden Scholaren. Das bekannteste dieser Sammlung ist wohl das Lied: meum est propositum in taberna mori, das so recht die Gesinnung der damaligen Zeiten offenbart. In der vierten Strophe dieses Liedes heißt es z. B.
Vinum super omnia bonum diligamus, nam purgantur vissia dum vinum potamus; cum nobis sit copia, vinum dum vocamus, qui vivis in gloria, te deum laudamus.
Jeder Bezirk menschlichen Lebens, Kirche und Staat, Gesellschaft und Einzelmensch, kommen zu ihrem Recht. Diese Anthologie enthält moralisch-satirische Dichtungen, Minnelieder, Trinklieder und ähnliche Kommersbuchliteratur. Die reiche Fülle der Sauf- und Trinklieder wurde unter der Einwirkung des Gesellschafts- und Volksliedes im 18. Jahrhundert mehr und mehr verdrängt. Die Befreiungskriege und das Aufkommen der Burschenschaften förderten die Verbreitung vaterländischer Lieder. Das 19. Jahrhundert brachte mit der Blüte des Verbindungswesens auch eine besondere Pflege der Studentenlieder. Neben eigens für die Studenten verfaßten stand vor allem das Volkslied.
Das Studentenlied in unserer Zeit Als nach dem zweiten Weltkrieg eine kleine Schar junger katholischer Studenten das Korporationsleben an den deutschen Universitäten und Hochschulen wieder belebten, fanden sich in ihren Reihen
meist solche, die nicht kritiklos die ausgetretenen Pfade der Alten gehen wollten. Sie suchten neue Formen der Gemeinschaft, die dem harten und nüchternen Zug der Zeit entsprachen. Ohne ganz mit der Tradition zu brechen, zogen sie sich aus dem Zwang und der Lüge einer bürgerlichen Gesellschaft zurück. Das Gute und Wertvolle der studentischen Tradition wurde willig und gern übernommen. Der gleiche Geist der Wahrheit und Echtheit sichtete kritisch und oftmals mißtrauisch das überlieferte studentische Liedgut. Hübscher Singsang und Klingklang waren nicht beliebt. Die verlogene Romantik von Landsknechten, Seeräubern und Vaganten, anempfundene Stimmungen und Erlebnisse, auch wehleidiges Schauen auf die Vergangenheit waren gerade das Gegenteil von dem, was man suchte: Echtes, Wertvolles, Zeitansprechendes. Die Herausgeber des neuen KV-Liederbuches haben es verstanden, Verklungenes und Verstaubtes, selbst wenn es früher in Ehren bestanden hatte, auszustoßen. Schon die Tatsache, daß es ein Liederbuch und kein Kommersbuch geworden ist, zeigt deutlich den anderen Geist, der nach dem zweiten Weltkrieg in unseren Reihen Einzug gehalten hat.
Gültige Maßstäbe In einem Aufsatz in den Akademischen Monatsblättern Nr. 4, 64. Jahrg. 1952, hat Prof. Dr. Felix Oberborbeck die Maßstäbe aufgezeigt, die wir an das überlieferte Liedgut anlegen müssen. Es sind Richtmaße musikalischer und textlicher Art. Einmal gilt es, sich von den rührseligen Gelegenheitsversen und Machwerken zu trennen, mit denen uns das 19. Jahrhundert in so reichem Maße beschenkt hat. Zum anderen trennen uns musikalische Gründe vom Zeitgeschmack der Jahrhundertwende. „Lieder, die eine Duodezime und noch größeren Umfang haben, sind keine Lieder, sondern Trompetensolis" (Oberborbeck). Chromatisches Abweichen von der Tonart wirkt sentimental. Wir können uns nicht mehr wie ein schwärmerischer Don Juan geben und in opernhaft sich gebärdenden Gesängen ein Gefühlsleben vortäuschen, das wir nicht nur nicht besitzen, sondern auch als verlogen ansehen. Wer mit dem deutschen Volkslied vertraut ist, der weiß, wie groß der Schatz ist, der sich uns hier darbietet. Unser KV-Liederbuch hat eine gute Auswahl getroffen und auch der alten Burschenherrlichkeit ein wenig Raum gelassen. Wenn solche Lieder auch nicht dem Lebensgefühl der heutigen studentischen Jugend entsprechen, so besitzen sie doch Erinnerungswert. Im ganzen gesehen haben wir es nicht nötig, uns von Außenstehenden kritisieren zu lassen. Denn unser Liederbuch bietet eine bunte Fülle von Volksliedern, ausgesprochenen Studentenliedern und auch von solchen Liedern, die einen neuen Ton anstimmen und in den beiden letzten Jahrzehnten in Jugend und
Volk bekannt wurden. Endlich dürfen auch die Spaßlieder nicht fehlen, die zu jedem jugendlichen Gemeinschaftsleben gehören. Der neue Stil des Korporationswesens spiegelt sich auch im Liedgut.
Aus dem Gesamtbereich studentischen Gemeinschaftslebens läßt sich die Pflege des Liedes damals wie heute nur schwer ausschließen. Aber eines scheidet unsere Liedkultur von der Studentenmusik vergangener Zeiten: Uns fehlt das Schöpferische. Wenn behauptet wird, der Akademiker habe im öffentlichen Leben weitgehend seinen Einfluß verloren, so läßt sich diese Behauptung im kulturellen Bereich erhärten. Hier haben andere die Führung übernommen. Nicht in unseren Reihen entstehen die Lieder, die heute auch als moderne Schöpfungen in weiten Kreisen der Jugend gesungen werden. Besonders die Jugendbünde haben durch neue Lieder und durch die vorbildlichen Sammlungen wie der „Spielmann", Das „Altenberger Singebuch" und Fritz Jodes „Musikanten" hervorragende Bedeutung gehabt für die Erneuerung des Liedgutes. Um mehrstimmiges Singen mühen sich zahlreiche Chorgemeinschaften in Stadt und Land. In der Kirche ist die Sammlung „Das Kirchenlied" beispielgebend gewesen für die neu erschienenen Gesangbücher der Diözesen. Wenn der Vergleich so offensichtlich zu unseren Ungunsten ausfällt, soll darin doch kein Vorwurf liegen, sondern nur die Tatsache an sich soll festgehalten werden.
Bedeutung der Lieder für unsere Gemeinschaften Das Lied bedeutet für unsere zahlreichen Gemeinschaften sehr viel, weil nur im Singen viele erst die Gemeinschaft erfahren. Durch gemeinsamen Gesang fühlt sich der Gast, der im ersten Semester eifrig seine morgendlichen Kollegs hört, abends aber fröhlich am Kneiptisch einer Korporation sitzt, mit den übrigen verbunden, und auch der älteste Bursch singt gerne die lustigen Lieder mit, die einen Trunk in froher Runde begleiten.
So nimmt das Lied auch einen wichtigen Platz in der Gestaltung unserer gemeinschaftlichen Feiern ein. Der feiernde Mensch löst sich aus dem Getriebe und der Mühsal der Arbeit und entspannt sich, um aber gerade in der Ruhe und Besinnlichkeit eines Festes eine neue Art der Aktivität zu entfalten, die durch eine gestaltete und geformte Feier gelenkt sein will. Neben Vorträgen, Reden und Lesungen kann das Lied wesentlich zur Gestaltung eines solchen Festes beitragen, wenn es wohlüberlegt und zum Ganzen des Festes passend ausgewählt wird. Ja, es hat den übrigen Gestaltungsmitteln das eine voraus: Singen bietet Gelegenheit zu gemeinsamem Tun. Der einzelne wird durch das Lied dem Ganzen verbunden. Auch manifestiert sich
im Lied ein gemeinsames Wollen. Auch von daher gesehen ist es wichtig, denn unsere Korporationen betonen ja in ihren Festen nicht nur ihr eigenes Leben, sondern sie bekunden ihren Lebenswillen und besinnen sich auf ihre Ziele. Wieviele und unterschiedliche Menschen ein Lied in gemeinschaftlichem Wollen einen kann, das zeigt als bestes Beispiel eine Nationalhymne. Allerdings lassen sich solche Möglichkeiten nur nutzen, wenn die Korporation ihr Singen pflegt und nicht den einmal erworbenen Liedschatz langsam verkümmern läßt. Es sollte das Ziel einer jeden Korporation sein, sich unser KV-Liederbuch allmählich zu ersingen. Wie man das macht, bleibt der Findigkeit der einzelnen Korporation überlassen. Es sollte aber eine allgemeine Regel werden, keine Fuchsenstunde vergehen zu lassen, ohne daß man sich um ein neues Lied bemüht hätte. Man muß sich an ihnen immer und immer wieder versuchen, bis sich die Schönheit dieser Lieder öffnet.
Wer etwas kultiviert singen will, der muß besonders bedenken, daß jedes Lied seine eigene Seele hat. Das eine ist feierlich-ernst, das andere leicht und hüpfend. Wer beide in gleicher Lautstärke dahin-schmettert, der hat einiges übersehen. Auch jede Strophe hat ihr eigenes Maß und ihren eigenen Sinn. Wort und Weise müssen aufeinander abgestimmt sein.
Josef Pollmann Der Gottesdienst im studentischen Bereich hat heute ein anderes Gesicht und Gewicht wie früher. Mit dem Früher sind gemeint die langen Jahrzehnte der Verbände, die primär von der Tradition getragen wurden und die noch gar nicht weit zurückliegenden Jahre nach dem Zusammenbruch, in denen aus der absoluten Katastrophe langsam wieder studentisches Eigenleben wuchs. Hier war Tradition abgebrochen und wurde auch weithin von den Studenten bewußt abgelehnt. Inzwischen hat sich ein neuer Konservatismus entwickelt, der zu charakterisieren wäre durch das realistische Fragen nach dem Seienden, und der das Bestehende als eben nur eine Möglichkeit des Seienden sieht und somit eine Wandlung von Bestehendem nicht nur als möglich erkennt, sondern als notwendig mitherbeizuführen gewillt ist. Auch der Konservative weiß: nichts ist, das sich nicht wandelt. Er setzt nur tiefer an als der Liberale oder Revolutionär, verwirklicht das Erkannte zwar langsamer, aber sicherer und tiefgreifender.
Die Kirche gilt als „stockkonservativ" in einer, besonders der Jugend häufig ärgerlichen Weise. Aber ob nicht doch in ihr, hinter Verkrustungen mehr konserviert Neues steckt als mancher Neanias wissen kann? „Das Wahre war schon längst gefunden, hat edle Geisterschaft verbunden; das alte Wahre faßt es an." (Goethe) Gerade heute zeigt sich die alte Kirche überraschend frisch und jung, selten in ihrer Geschichte war sie so zeitnahe in ihren Verkündigungen und Reformen. Sie handelt „gleich einem Hausvater, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervorholt." (Matth. 13, 52.) Besonders eindrucksvoll hat sich diese Haltung eines besonnenen Neuerungswillens gezeigt im Bereich des Liturgisch-gottesdienstlichen. Nach revolutionsähnlichen Aufbrüchen ist in der Kirche eine neue Kraft am Werk, die noch von den Impulsen der liturgischen Bewegung lebt, sich aber nach vielfältigen Erfahrungen in feste Formen fügt, die jetzt als gesammelte Kraft ständig immer mehr Bereiche der Gesamtkirche ergreift.
Ähnlich glauben wir die Entwicklung der Studentenschaft nach 1945 sehen zu dürfen. Ihre eigene Welt ist nicht isoliert von der größeren Umwelt der Gesamtheit, und deren objektiver Geist wird in der Jugend nur offenbarer. Dieser Geist eines neuen Konservatismus, der in der Kirche als ein ihr besonders eigentümlicher, häufig als reaktionär mißverkannter, heute als echten Fortschritt tragend akzeptiert und anerkannt wird, hat die katholische Studentenschaft in einem früher nie gekannten Maße offen gemacht für das Verständnis kirchlicher Innenbereiche und eine Bereitschaft zu einsatzwilligem Tun geschaffen. So kann und muß ein solches Thema wie dieses heute in einem Buche eines katholischen studentischen Verbandes erscheinen. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der einfachen Überlegung, daß die Studentenschaft dafür aufgeschlossen ist und die Religio als erstes Prinzip versteht in dem Sinne, wie er Allgemeingut der katholischen Jugend heute ist. Diese Notwendigkeit ergibt sich auch aus dem Zwang, den Gottesdienst so gestalten zu können, daß aufgeschlossene junge Christen sich nicht in eine überholte Art der Gottesdienstform hineingezwungen fühlen.
Wenn die Väter als erstes Prinzip ihrer studentischen Gemeinschaft die Religio ansahen und formulierten, dann ist das heute gültig wie eh und je. Doch muß gefragt werden nach unserem heutigen Verständnis der religio, das wir aus schweren geistigen Erfahrungen gewonnen haben, „religio" hat ein besonderes Gewicht und Gesicht für die in Katastrophenjahren geborene und aufgewachsene Jugend.
Das Gewicht Der Weg christlicher Besinnung hat von der Religio zum Glauben geführt. Was heißt das? Zunächst, daß hier in den letzten Jahrzehnten eine umgekehrte Bewegung erfolgte, wie in dem Jahrhundert, mit dem wir die Neuzeit einsetzen lassen. Bis ins 16. Jahrhundert nämlich waren Wort und Begriff „religio" bei uns ungewohnt. Man sprach vom Glauben oder vom Bekenntnis, und erst im 19. Jahrhundert drang der „Religionsunterricht" in unsere Schulen ein. Da das „Ende der Neuzeit" spürbar wird, kann der Begriff Religio in der alten Deutung nicht mehr genügen. Gott wurde neu erfahren als der frei schaffende, herrische und herrliche, absolute und persönlich sprechende Urheber des Daseins, wurde neu erkannt als der fordernde und Ansprüche stellende Herr unseres Lebens.
Damit kann Religio als erhebendes Gefühl, als allgemeine Daseinserfahrung, ja sogar als Bewußtsein letzten Gesetzen gehorsamer Pflichterfüllung nicht genügen.
Darüber hinaus war die Religio schon von Hegel als Form des objektiven Geistes in gemeinschaftlicher, kultischer Gottesverehrung benannt worden.
Gott fordert die persönliche, wissende Entscheidung im Glaubensvollzug und die gläubige Anerkennung im Kult als der Gemeinschaftsfeier des sozialen Wesens Mensch.
Gottesdienst aber wird zur Liturgie in der Gemeinschaft der Kirche. Liturgie ist Dienst, und nicht in das Belieben des einzelnen gestellt. Liturgie ist Dienst vor dem lebendigen Gott und daher personales Tun und Sprechen. Die Spannung zwischen Dienst und persönlicher Entscheidung ist der Liturgie wesensnotwendig, wenn sie nicht in leeren Formalismus oder gegenstandslose Emotionen des einzelnen ausarten soll.
Der Kern aller Liturgie ist die Eucharistiefeier, die für die meisten Gläubigen die einzige Form ihrer aktiven Teilnahme am Gottesdienst der Kirche ist und sein kann. Die Teilnahme muß aktiv sein, denn Liturgie wird getragen von den einzelnen Christen in der Gemeinschaft des geheimnisvollen Herrenleibes. Die Anteilnahme des einzelnen aber ist verschieden nach seiner Aufgabe, die er im Gottesdienst hat. Durch die jedem eigen-artige Form der Anteilnahme kommt auch der einzelne Teilnehmer zu der notwendigen inneren Kontaktnahme.
Soll Liturgie gestaltet werden, ein deutliches, der vertieften Einsicht in ihr Wesen entsprechendes Gesicht bekommen, ist also Voraussetzung nicht nur das lebendige Mittun in der Gemeinschaft,
sondern die rechte Verteilung der den einzelnen „Mitspielern" typischen Aufgaben und das Beherrschen des jeweiligen „Parts".
Das Gesicht Es erleichtert das Verständnis des Sachverhaltes, wenn wir wissen, daß es früher beim Gottesdienst der Eucharistie nicht nur ein Meßbuch (Missale, Schott) gegeben hat. Zur Feier der Eucharistie waren mehrere Bücher notwendig, die jeweils die Texte (und nur diese) der einzelnen Funktionsträger enthielten. Der Priester, der Lektor, die Schola, der Chor sind solche Funktionsträger, ebenso wie das Volk selbst, aber auch der Organist, die Altardiener und der Sakristan, die je ihre Rolle zu spielen hatten. Die Gestalt der Meßfeier erwächst aus dem Miteinander der verschieden gearteten Träger der Handlung. Sie hat darum, wenn diese Voraussetzung gegeben ist, optische und akustische Tiefe und bezieht schon durch die äußere Gestaltung alle Anwesenden in ihren Ablauf mit ein.
Wenn wir ein Vorstellungsbild suchen, bietet sich das des modernen Zimmertheaters an, wo jeder mitspielt, und auch die Zuhörer aktiv miteinbezogen werden. Die liturgische Bewegung sucht diese Möglichkeiten wieder zu realisieren. Den gleich aufzuzeigenden Grundarten der gemeinsamen Meßfeier liegt diese Vorstellung der Eucharistie als eines Dramas zugrunde.
Grundarten der gemeinsamen Eucharistiefeier I. Das Hochamt ist die Grundform der Eucharistiefeier. Wir können drei Stilformen des Hochamtes unterscheiden. Allen drei Formen ist gemeinsam, daß der Priester die ihm zustehenden Teile lateinisch singt. 1. Das lateinische Hochamt.
Die Ordnung liegt durch Tradition und kirchliche Bestimmungen fest. Sie ist allgemein als Choralmesse bekannt und bildet mit ihrer Grundstruktur den Kanon für alle Meßformen. Die Lesung kann vom Lektor deutsch (gesprochen oder gesungen) vorgetragen werden, wenn sie vom Priester angesungen worden ist. Dasselbe gilt vom Evangelium. Nur muß hier der Priester das ganze Evangelium zunächst lateinisch gesungen haben. Die Verkündigung des Evangeliums in deutscher Sprache wird sinnvoller Weise der Priester möglichst selbst vollziehen. Ein deutsches Lied zum Ausgang zu singen, ist alte und allgemeine Gewohnheit.
- Das Hochamt mit deutscher Gregorianik.
Die Gemeindegesänge und die Scholagesänge werden deutsch gesungen in der Vertonung der sogenannten deutschen Gregorianik. Zu beachten ist, daß diese deutsche Gregorianik noch im Stadium des Versuches steckt, und bisher nur einige überzeugende Umformungen gelungen sind. Die Kirche hat deswegen zur Vorsicht gemahnt. Doch werden lebendige Gruppen hier immer eine Aufgabe sehen. Das unter 1. von den Lesungen Gesagte gilt auch hier. Ein am Schluß gesungenes Kirchenlied fügt sich dieser deutschen Hochamtsform organisch ein.
- Das Deutsche Hochamt.
In einigen Diözesen ist das sogenannte Deutsche Hochamt seit Jahrhunderten der Normalfall des sonntäglichen Gemeindegottesdienstes. In anderen hat man seine Bedeutung für die Gemeinde erkannt und fördert es kräftig.
Die Gesänge der Gemeinde und der Schola werden ersetzt durch deutsche Kirchenlieder. Eine Schwierigkeit liegt in der nicht ausreichenden Zahl von qualifizierten Kirchenliedern. Man kann sich oft helfen durch geschickte Strophenauswahl. Auch hier gilt von den Lesungen das unter 1. Gesagte. Zum Eingang und zum Ausgang wird man ein Kirchenlied singen, das der jeweiligen Festfeier entspricht.
Formen der „gesprochenen" Messe.
- Die Missa recitata.
a) Die lateinische Missa recitata.
Die Ordnung entspricht genau der des lateinischen Hochamtes, nur wird alles, was dort gesungen wird, hier laut gesprochen. Die Pausen, die durch das weniger Zeit in Anspruch nehmende Sprechen entstehen, sollten nicht durch andere Gebete oder Gesänge ausgefüllt werden. Die Verkündigung des Wortgottesdienstes geschieht in deutscher Sprache.
b) Die deutsche Missa recitata.
Sie entspricht dem deutschen gregorianischen Hochamt. Bei der deutschen und lateinischen Missa recitata sollte auch zum Beginn des Gottesdienstes ein deutsches Kirchenlied gesungen werden. Die Zeit erlaubt es, und die Feier verlangt eine Eröffnung.
- Die sogenannte Gemeinschaftsmesse.
Der Name ist irreführend, da in jeder Meßform nicht nur die innere Gemeinschaft, sondern auch die äußere in variabler
Weise gegeben ist. Doch hat sich die Bezeichnung aus historischen Gründen eingebürgert und eine Verständigung unter diesem Namen ist schnell möglich.
Gegenüber dem Hochamt und der Missa recitata ist die Gemeinschaftsmesse weniger übersichtlich, weil sie eine Mischform darstellt, die aus pädagogischen Gründen in Anpassung an die jeweilige Gemeinde entstanden ist und damit unterschiedlich gehandhabt wird. Doch sollte man aus Gründen der Disziplin und der Einheitlichkeit sich an die bischöflichen Richtlinien betr. Gemeinschaftsmesse halten. Ihre Sonderheit besteht in der Einführung eines Vorbeters, der in etwa tut, was Amt des Diakons ist: er vermittelt zwischen Priester und Gemeinde. Er spricht die Schola-Teile und intoniert die Gemeindeteile. Eine zweite Besonderheit besteht darin, daß einige Gebete deutsch gesprochen werden, die eigentlich Priestergebete sind oder bei den anderen Meßformen nur still gebetet werden, wie das Pater noster und das Domine non sum dignus. Zum Beginn und zum Schluß wird ein Kirchenlied gesungen.
Ein weiteres Entgegenkommen ist notwendig gegenüber Diasporagemeinden und Jugend- bzw. Kindergottesdiensten. Diese Möglichkeiten pädagogischer Vorformen brauchen im Rahmen dieses Beitrages, der sich auf den Gottesdienst in der studentischen Welt beschränkt, nicht besprochen zu werden. III. Die sogenannte Bet-Singmesse.
Sie unterscheidet sich vom deutschen Hochamt nur dadurch, daß der Priester nicht singt. Hier wie dort übernimmt die Gemeinde auch den Part der Schola, durch das den Gesangsteilen der Messe entsprechende Singen deutscher Kirchenlieder. Steht eine Schola zur Verfügung, betet diese die sog. Schola-Teile. . In dem lebendigen Miteinander der einzelnen Rollenträger verliert die Meßfeier ihre häufig empfundene Monotonie. Dabei wird das Ganze um so mehr gewinnen, als die einzelnen „Rollen" von ihren Trägern erfüllt werden und gekonnt sind. Vor-Überlegung und Vorübung ist unerläßlich, wenn der einzelne die Sicherheit des Könnens haben soll. Aber wird dadurch, daß jeder nur seine „Rolle spielt" —so lautet ein öfter gehörter Einwand — nicht die persönliche Anteilnahme am inneren, wesenhaften Geschehen der Meßfeier gestört oder unmöglich gemacht? Die Antwort lautet: Wenn das intentionale Gerichtetsein des ganzen Menschen das Wesen eines Geschehens meint, d. h. hier: auf das Opfer und das Mahl bezogen ist und die Wahrheit, die in der Verkündigung liegt, offenbar wird, ist der Kontakt lebendig
da. Denn der Umfang des Bewußten ist weiter als der des aufmerksam Bewußten. Es kommt nicht darauf an, daß man „alles mitbekommt". Wer die rechte Intention hat und das Seine verantwortlich tut, nimmt gerade dadurch im Vollsinne der Eucharistie an der Feier teil.
Der dramatische Charakter der Meßfeier kommt nicht nur zur Geltung in den verschieden gewichtigen Sprechrollen, sondern auch in den sinnvollen Bewegungsäußerungen der Anteilnehmenden. Dem Geschehen entsprechend wird man mit den anderen sitzen und knien, gehen und stehen. Die Einheitlichkeit dieser Bewegungsäußerungen sollte nicht erzielt werden durch eine äußere Anordnung, sondern sich ergeben aus den auch sonst allgemein gültigen menschlichen Verhaltungsweisen. Die Regel heißt hier: Was man im Leben allgemein sinnvoll tut, tut man auch so im Gottesdienst.
„Was wir hier besprochen haben, ist Anleitung zum Tun. Das Lesen allein hilft genauso viel und so wenig wie das Lesen eines Sportbuchs zur körperlichen Ertüchtigung hilft. Das Entscheidende ist hier wie dort, daß man mutig anfängt, an irgend einer Stelle und — daß man durchhält." (Klemens Tilmann in „Täglich beten, aber wie?")
Unser Kartellverband
Vom Wesen des KV und seiner Erscheinungsform heute
Paul Benkart
Da steht in der Gegenwart ein korporationsstudentischer Verband mit einer fast hundertjährigen Geschichte. Trotz der von der nationalsozialistischen Regierung verfügten Auflösung, hat er sich nach der Katastrophe von 1945 wieder neu gebildet und zählt heute Tausende von Mitgliedern. Will man sich von dieser Lebenskraft ein rechtes Bild machen, muß man die Frage nach den Grundlagen, dem Wurzelgrund, d. i. den Prinzipien stellen. Damit ist die Frage nach Inhalt und Pflege der Tradition verbunden. Die Erscheinungsform wandelt sich dem Zeit- und Lebensgefühl gemäß. Darum geht es hier um eine Erörterung des genannten Fragenkreises. Mit Hilfe der geschichtlichen Vorgegebenheiten wollen wir den Kartellverband als Phänomen unserer Zeit in den Blick bekommen. Zum besseren Verständnis diene noch die Vorbemerkung, daß der Katholik Religion und Leben nicht voneinander trennt, Werte wie Vaterland und Ehre beispielsweise sehr hoch schätzt (Man erinnere sich des Ausspruchs von Maria Ward, Stifterin des Institutes der Englischen Fräulein 1609: „Schätze deine Ehre höher als dein Leben! Achte es jedoch gering, um der Liebe Jesu Christi willen beides zu verlieren!"), bei ihnen aber als vorletzten Werten nicht stehenbleibt, sondern alles in Gott, als dem absoluten Urwert begründet.
Der Aufbruch
Bewußt und entschieden bekennt sich der KV zu den Leitgedanken, die seine Gründer bestimmten. Er stellt sich damit in eine Tradition von über einem Jahrhundert. In diesem Zusammenhang ist es völlig belanglos, zu welchen Zeitpunkt seine organisatorische Begründung erfolgte. Wesentlich ist, daß das Leitbild des KV-Studententums seinen Ursprung hat in der Glaubenskraft jener katholischen Studenten, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts dem Reiche Gottes auch den Bereich der akademischen Gemeinschaften einverleiben wollten. Da war im Gefolge des Kölner Ereignisses von 1837 und der 1848 geschenkten Vereinsfreiheit der Wille aufgebrochen, Gott und seiner Kirche Raum zu schaffen in einem Lebenskreis, in dem Religion und Katholizismus keinen oder nur geringen Kurswert besaßen. In klarer Entscheidung stellte man sich gegen die herrschende Zeitmeinung der Unvereinbarkeit von Glaube und Wissen.
Religion zum Prinzip zu erklären, d. i. zum Lebensgrund, zum Boden, in dem man wurzelt und aus dem man seine Lebenskraft zieht, verlangte damals besonderen Mut und feste Entschlossenheit.
Wir brauchen uns nur daran zu erinnern, daß in jenen Jahrzehnten D. Fr. Strauß sein „Leben Jesu" herausgegeben hatte, in dem alles übernatürliche ausgemerzt und alles Innerweltliche absolut gesetzt wurde. Ludwig Feuerbach (1804—1872) dozierte seinen Sensualismus, seinen atheistischen Humanismus. 1841 erschienen sein Buch „Das Wesen des Christentums" und 1845 die Vorlesungen über „Das Wesen der Religion". Feuerbach beabsichtigte, „die Deutschen aus Theologen zu Anthropologen, aus Theophilen zu Philanthrologen, aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits, aus religiösen und politischen Kammerdienern der himmlischen und irdischen Monarchie und Aristokratie zu freien, selbstbewußten Bürgern der Erde zu machen." Karl Marx (1813—1883) und Friedrich Engels (1820—1895) begrüßten den Kampf und führten ihn selber gegen jedwede Religion.
Welch tiefgehende Wirkung hatten diese „wissenschaftlichen" Ideen in den Köpfen gerade der akademischen Jugend! Und dieser aggressiven Religionsfeindlichkeit stellten sich junge Katholiken entgegen und trotzten dem Zeitgeist.
Dieses „radikale" Wollen, d. h. der Wille, von der Wurzel her zu leben, führte zur Gemeinschaftsbildung, zur Sammlung der Kräfte. Unbestreitbar war damit ein Neues in Angriff genommen.
Die große Prinzipienrede
Wovon die Gründer beseelt waren, hat der zwanzigjährige Freiherr Georg von Hertling auf der fünfzehnten Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands zu Frankfurt am Main (21. bis 24. September) im Jahre 1863 ausgesprochen. Der junge Student der Philosophie weiß sich als Sprecher dreier katholischer Studentenvereine und stellt sie in ihrem Wollen und Wirken dem katholischen Deutschland vor. Ausgehend von der Gefahr zügelloser Freiheit in der Zeit des Studiums, falscher Wissenschaftsideale an der Universität, spricht von Hertling den sehr treffenden Gedanken aus: Mag der katholische Studenten sich auch Glaube und Sitte bis zum Eintritt ins Leben bewahrt haben, in seinem Beruf tüchtig und ein treuer Beschützer seiner Familie sein, die Einsatzbereitschaft für die Kirche, der Wille zur Wahrheit fehlen indes, wenn in der idealgesinnten Jugend nicht das Feuer der Begeisterung entfacht wurde. Dann fährt er fort:
„In den Studenten selbst erwachte darum das Bedürfniß, nicht alleinzustehen in jener wichtigen Zeit, sondern durch den Anschluß an Gleichgesinnte, durch gegenseitige Anregung den Halt und die Stütze zu finden, die für sich selbst die Universitäten nicht bieten. Dieser tiefere Gedanke in Verbindung mit dem natürlichen geselligen Drang der Jugend führte zu jenen dem deutschen Studentenleben eigentümlichen, von dem Fremden stets angestaunten Studentenverbindungen. Jedoch können wir uns nicht verhehlen, daß abgesehen von der eigentümlichen Erziehung, die jedes Gemeinwesen mit sich bringt, die Studentenverbindungen, wie sie noch heute vor uns liegen, im Großen und Ganzen ihre Aufgaben allzuwenig gelöst haben.
Denn die Einen, ausgehend von einem falschen Ehrbegriff, stellten mit Vernachlässigung aller geistigen Interessen eine gewisse Ritterlichkeit an die Spitze ihrer Bestrebungen, die deßhalb bald in bloße Geselligkeit und leeren Formenkram ausarten mußten.
Eine andere Richtung suchte den überkommenen alten Formen einen neuen geistigeren Kern einzuflößen, da sie in der Idee die Vaterlandsliebe sahen. Aber die Vaterlandsliebe, so sehr sie gewiß einem jeden deutschen Studenten ans Herz gewachsen ist, vermag doch nimmer für sich allein einen ganzen Organismus lebenskräftig zu durchdringen, und jene Vereine, die sich auf sie allein gestützt hatten, mußten dazu kommen, mit Verkennung des studentischen Standpunktes praktische Politik treiben zu wollen, sich als politisches Kapital mißbrauchen zu lassen. Jene Versuche in Erwägung zu ziehen, die auf spezifisch-protestantischem Gebiete mit besserer Erfassung der Aufgabe gemacht worden sind, kann meine Aufgabe nicht sein, sie hatten sicher das Gute, daß sie erkannten, wie die Aufstellung eines sittlichen Prinzips und wirkliche Charakterbildung nur auf dem Grund der Religion möglich sei, und daß sie sich nicht scheuten, manchen Auswüchsen des Studententums mit Ernst entgegenzutreten.
In den sturmvollen Tagen des Jahres 1848 aber, wo so viel Altes zu Boden sank und aus dem gährenden Grunde Neues erwuchs, wo sich in wunderbarer Weise die ewig junge Macht unserer heiligen Kirche bewies, die allein, wie die Gegner zürnend sagen, Nutzen aus den Stürmen und Kämpfen zog, da sollte der katholische Geist, wie er in weiten Kreisen die neuen Ideen klärte und läuterte, und zu heilsamen Institutionen führte, auch in den Studentenkreisen, wo die Freiheitsstürme vielleicht lebhafter als anderswo empfunden wurden, seine Kraft bewähren. Und wie sich die damalige katholische Bewegung besonders in dem frisch autblühenden Vereinswesen kund gab, so entstanden jetzt auch seit 1851 katholische Studentenvereine, einig in dem letzten Ziele aber verschieden je nach lokalen Verhältnissen. So trat die älteste, Aenania in München, an der katholischen Universität zunächst den Ausartungen des Studentenlebens entgegen. Dem Mißbrauch der akademischen Freiheit wollte sie den richtigen Gebrauch gegenüberstellen; sie akkommodierte sich daher völlig der studentischen Form und trug mit ihren Farben mutig ihr Prinzip nach Außen. Ihr entspricht am Meisten Winfridia, die 1855 an der paritätischen Universität Breslau entstand. Dem katholischen Leseverein endlich, der 1853 in Berlin gegründet wurde, stand die große protestantische Stadt gegenüber, ihn zeichnet dem entsprechend ein inniger Zusammenhang mit dem ganzen dortigen katholischen Vereinsleben aus, auch ist er nicht rein studentisch. Diese neuen Vereine glichen den bezeichneten Versuchen auf protestantischem Gebiete darin, daß sie vor Allem der Religion die gebührende Stelle im Kreise der Mächte anweisen, die auf das Studentenleben einwirken. Sie erkannten, wie uns auf der sicheren Grundlage der Religion ein lebenskräftiger Organismus erwachse, nur durch das Band der Religion alle andern Ideen zu einem harmonischen Ganzen vereinigt werden könnten. Nur an der Hand eines religiös-sittlichen Prinzips glauben sie die erste Aufgabe lösen zu können, die sie sich stellten: die Heranbildung echt männlicher Charaktere. Als zweite Hauptaufgabe aber stellten sie sich die Teilnahme an dem großen religiös-wissenschaftlichen Kampfe der Gegenwart. Sind doch die Studenten bestimmt, Träger der geistigen Bewegung der Zukunft zu werden und ist es doch vor allem ihr Beruf, sich zu rüsten und zu wappnen zum Vernichtungskampf gegen den Geist der Verneinung, der durch den glänzenden Schein einer falschen Wissenschaft fortwährend Tausende dem Glauben entfremdet Alles, was die überkommenen alten Formen Gutes und Schönes in sich tragen, ziehen sie mit Freuden in ihren Bereich und beleben sie zu frischem Glänze durch das Einflößen eines neuen geistigen Inhaltes. Im schönsten Maße wird gewiß Freundschaft und Geselligkeit dort blühen, wo ein gemeinsames Ziel alle vereint, wo wissenschaftliche Bestrebungen der Unterhaltung stets eine geistige Würze geben und der religiös-sittliche Ernst alles fern hält, was die reine Fröhlichkeit trüben könnte.
[...] Wie es aber stets ein Vorrecht des Wahren und Guten gewesen ist, die heftigsten und verschiedenartigsten Gegner zu finden, so dürfen auch unsere Vereine sich rühmen, seit der Zeit ihres Entstehens auf das hartnäckigste angefeindet worden zu sein. Wenn wir von Jenen absehen, die überhaupt allem Katholischen und allem Christlichen feind sind, und die zu bekämpfen uns mit allen katholischen Vereinen gemeinsame Pflicht und Ehrensache ist, so bleiben uns noch drei Reihen spezieller Gegner unserer Vereine. Erstlich jene, die zwar unsere Grundsätze teilen, aber eine konfessionelle Scheidung als dem Geiste der Universitäten widersprechend betrachten. Ihnen entgegnen wir, daß die Zeit der Vorbereitung nicht zu trennen ist von der Zeit der Tat, und daß dem Studenten schon jene Richtung aufgeprägt werden muß, die er im späteren Leben zu verteidigen berufen ist.
Eine zweite Art von Feinden aber, vornehmlich in Studentenkreisen, sind jene, die sich noch nicht losreißen können von den alten Studentenverbindungen mit ihren Mißbräuchen. Sie werden immer mehr verschwinden, je mehr das Bewußtsein sich Bahn bricht, daß unsere Zeit eine Zeit des geistigen Kampfes geworden ist, und daß den Anforderungen, die sie an den Studenten stellt, nicht mehr äußerer Prunk und körperliche Auszeichnung genügen kann. Weit schlimmer ist jenen katholischen Studentenverbindungen die dritte Reihe von Gegnern, die zwar unsere Bestrebungen teilen und wünschen, daß sie auch in studentischen Kreisen gefördert würde, aber doch uns bekämpfen zu müssen glauben, weil sie sich entweder die studentische Form nicht getrennt denken können von ihren Mißbräuchen und Ausartungen oder nicht genug die Zwecke jener Studentenverbindungen kennen [...]
Zuversichtlich hoffen wir, daß die Zeit nicht mehr ferne sei, wo auf allen deutschen Universitäten um das Banner, das wir uns erwählt haben, eine Schar wackerer Streiter sich reihen wird, wo an allen deutschen Universitäten katholische Studentenvereine entstehen werden, die als das jüngste, aber an Opferwilligkeit und Begeisterung nicht ärmste Glied eintreten in den großen Organismus der katholischen Vereine." (Zitiert nach „Verhandlungen der fünfzehnten Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands zu Frankfurt am Main am 21., 22., 23. und 24. September 1863". (Amtlicher Bericht Frankfurt am Main 1863, Verlag für Kunst und Wissenschaft.) Liest man den Text der Rede im amtlichen Bericht von 1863 nach, so merkt man noch heute deutlich, von welch kraftvoller Begeisterung der junge Hertling und seine Freunde befeuert gewesen sind. Diese erste „Prinzipienrede" fand auf dem Katholikentag deswegen so großen Beifall, weil bereits die erste Welle des katholischen Vereinslebens abgeebbt war. Karl Bachern schreibt davon in seiner „Vorgeschichte, Geschichte und Politik der Deutschen Zentrumspartei": „Zu Anfang der 60er Jahre machte sich ja eine allgemeine Ermüdung und Verdrossenheit des katholischen Lebens bemerkbar. Abgestoßen von den Auswüchsen des politischen Kampfes zogen viele Katholiken sich ganz aus dem öffentlichen Leben zurück. Kluge, klarblickende Männer suchten nach Kräften dieser Stimmung entgegenzuwirken. Die Gründung der „Kölnischen Blätter" 1860 entsprang diesem Streben. Ihm entsprang auch die berühmte „Männerrede" des Domkapitulars Moufang bei der Katholikenversammlung in Aachen am 10. September 1862, von welcher schon die Rede war. In ihr hieß es: „Es fehlt an Männern! Ein Mann ist nicht jeder, der den Frack oder auch den Waffenrock trägt, oder der einen Schnurrbart hat — ein Mann, das ist einer, der Gesinnung, der Charakter hat, der Farbe hat und der Farbe bekennt. Einen Mann nenne ich nicht denjenigen, der zu Hause weint und heult über die schlechten Zeiten, sondern der eingreift, um die Zeiten zu bessern. Einen Mann heiße ich nicht den, der bloß an sich denkt, nur an seinen Vorteil, an sein Geschäft, oder an seine Bequemlichkeit, sondern der kämpft und ringt und der hineintritt ins öffentliche Leben, um für seine Überzeugung zu kämpfen und der auch Opfer zu bringen bereit ist. Das ist ein Mann, und in diesem Sinne sage ich: Es fehlt unserer Zeit an Männern!" Es war diese wuchtige Rede eines musterhaften „Mannes", welche den jungen Fürsten Karl zu Löwenstein ganz und für immer der katholischen Sache und dem Dienste der Generalversammlungen der deutschen Katholiken gewann, als deren langjähriger Kommissar er sich später so große Verdienste erwerben sollte. Sie war es auch, welche im folgenden Jahre 1863 bei dem Katholikentage von Frankfurt a. M. den jungen Studenten Georg Freiherr von Hertling an das Rednerpult rief, um gewissermaßen „als Antwort auf den kurz vorher ertönten Hilferuf nach Männern" Kenntnis zu geben von dem Entstehen eines katholischen Studentenvereinswesens, welches im Laufe der Zeit eine so stattliche Zahl von „Männern" dem katholischen Leben zuführen sollte.(Karl Bachern, Dr. jur., Utr. Geh. Justizrat, II. Band, S. 210-211, Verlag J. P. Bachern, Köln 1927.)
Tradition
Mit diesem zielsicheren Streben in lebensvoller Verbindung zu bleiben, die Weitergabe des Errungenen als Aufgabe zu sehen, ist der Grund dafür, daß der KV Tradition pflegt und es auch heute noch wagt, junge Menschen in diese Tradition hinzustellen. Gar zu schnell, gar leichtfertig ist man vielfach bei der Hand, Traditionsgebundenheit abzutun und nur in abwertendem Sinne von ihr zu sprechen. Man bedenke, daß junge Männer damals die Initiative ergriffen in einer Zeit, da die gesellschaftlichen Widerstände aus unerschütterter Position erfolgten. Das gilt es in Rechnung zu stellen, wenn man diesen Beginn in Vergleich setzen will mit der Zeit nach 1918, mit der Zeit auch nach 1945, wo nach einem unvergleichlichen Zusammenbruch ein Aufbau bzw. eine Neubesinnung gefordert wurde. Mithin offenbart der Aufbruch katholischer Studenten zu Beginn der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ohne Anregung und Mithilfe der kirchlichen Hierarchie noch mehr Ursprünglichkeit und Lebenskraft als nach einer Zeit, da der Katholizismus sich bereits Ansehen und Geltung verschafft hatte. Stolz und bewußt steht darum der KV zu seiner Tradition und weiß sich ihr ungemindert auch heute noch verpflichtet. „Das Erbe stellt sich eher, als ein fortgesetzter Anruf dar, denn als die Übermittlung einer Habe." Dieser Satz Gabriel Marcels, des bekannten französischen Philosophen, findet ganz und gar seine Anerkennung. All denen, die geringschätzig von Tradition sprechen und abwertend vom „Altstudentischen" reden oder schreiben, sei des gewiß unverdächtigen obengenannten Philosophen Meinung zitiert: „Alles deutet darauf hin, daß Dankbarkeit und Staunen im gleichen Maße abnehmen, wie die schöpferische Kraft nachzulassen beginnt. Ich muß hinzufügen: Je mehr diese Kraft zu verschwinden droht, desto mehr tritt an ihre Stelle ein trügerischer und giftiger Ersatz: Der Anspruch des 'Niedagewesenen' mitsamt der Eitelkeit, die kaum davon zu trennen ist. Der Mensch, der in solchem Anspruch lebt, kreist um sich selbst, und das ist der tiefste Grund, warum er sich so oft weigert, etwas zu bewundern oder sich dankbar zu zeigen" (Gabriel Marcel, Das große Erbe, Tradition, Dankbarkeit, Pietät, Münster 1952). Zum tieferen Erfassen der Tradition sei auf „Kultur als Lebensform 1: Die Tradition" (Seite 344—345) verwiesen in: Johannes Messner, Kulturethik mit Grundlegung durch Prinzipienethik und Persönlichkeitsethik, Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien-München 1954.
Die Prinzipien
Das Wesensziel der katholischen Studentenvereine, von dem der junge Student Freiherr von Hertling in Frankfurt a. Main gesprochen hatte, fand in den auf der Generalversammlung der katholischen Studentenvereine im September 1864 zu Trier angenommenen Generalstatuten seine Formulierung: Religion, Wissenschaft und Freundschaft.
Im folgenden sei der Versuch gemacht, eine Neubesinnung auf Gehalt und Wirkmacht der altehrwürdigen Prinzipien des Kartellverbandes vorzunehmen. Würde man auch heute, dem derzeitigen Glaubensbewußtsein entsprechend, konkreter als erstes grundlegendes Prinzip „Kirche" wählen, an Stelle des allgemein gehaltenen „religio", so sei hier, von der Religionswissenschaft ausgehend, der Inhalt von Religion erschlossen und damit der Zugang in die Tiefe christlicher Offenbarungsreligion geöffnet.
Religion
Steht auch die Worterklärung für Religion nicht eindeutig fest, so lassen sich doch relegere (Cicero) sorgfältig, gewissenhaft etwas beachten und religare (Lactantius) binden, abhängig machen, in Zusammenhang bringen.
Die eine Ableitung betont mehr die Beachtung äußeren Verhaltens, die andere setzt den Akzent auf die innere Haltung. Religion beinhaltet etymologisch bereits den Zustand, die Gegebenheit einer Bindung, das Verhältnis von einem Bindenden zu einem Verpflichteten. Eingeschlossen ist damit für das Geschöpf aus Leib und Seele der Ausdruck der Abhängigkeit im wahrnehmbaren Kult.
Sehr beredtes Zeugnis dafür, daß Religion nicht mit Religiosität verwechselt werden darf, legt die Religionsgeschichte ab. Sie hat es niemals ausschließlich mit religiösen Menschen, sondern mit Religionen und den sie tragenden Gemeinschaften zu tun. Wie in die Sprachgemeinschaften, wächst der Mensch in die Religionsgemeinschaften hinein. Religiöses Leben, d. i. Religiosität, kann nur von den Religionen geweckt werden. Der religiöse Mensch ist nach Ausweis der Religionsgeschichte immer Mitglied einer Kultgemeinschaft. Dort, wo man sich nur um religiöse Persönlichkeiten scharte, war echte Religion schon im Zerfall und in der Auflösung begriffen. Da handelte es sich nur noch um Weltanschauung auf philosophischer Grundlage.
Die überwundene Religionswissenschaft des vergangenen Jahrhunderts hat mit ihrem individualistisch-psychologischen Religionsbegriff verhängnisvolle Irrtümer ausgelöst. Die vielfältigen Theorien vom Ursprung der Religion, wie beispielsweise Animismus, Magismus und wie immer sie heißen, hatten nur den einzelnen Menschen im Auge und suchten von ihm her das Wesen der Religion zu bestimmen. Selbst der angesehene Rudolf Otto läßt Religion aus einem numinosen Gefühl entstehen. Sein Mensch ist ein blutleeres Schemen, in keiner Weise eingebettet in Vergangenheit und Gegenwart, d. h. in einen geschichtlichen Ablauf. Hier läßt sich Otto selbst zitieren: Es ist „ein hoffnungsloses Geschäft, sich in das Gemütsleben eines Pithekanthropos zu versetzen".
Die Menschheitsgeschichte fängt mit dem Menschen an, die Religionsgeschichte mit Religion. Wo immer wir Religionen antreffen, besitzen sie Gemeinschaftscharakter. Wie treffend schreibt Walter Baetke, der bekannte evangelische Religionswissenschaftler zu Leipzig*): „Religion ist darum nicht eine individuelle und private, sondern eine soziale Angelegenheit wie die Sprache, ja sie ist ,une chose eminemment collective'. Sowenig wie ein Staat durch einen ,contrat social' entsteht, entsteht eine Glaubensgemeinschaft durch einen Zusammenschluß von Individuen mit gleichen religiösen Interessen und Bedürfnissen; vielmehr ist die Glaubensgemeinschaft das Primäre und das religiöse Leben des einzelnen durch sie bedingt. Daraus folgt, daß auch die Frage nach der „Entstehung" der Religion nicht vom religiösen Individuum aus — also psychologisch —, sondern von der religiösen Gemeinschaft aus — also soziologisch — zu beantworten ist. Die Kenntnisse dessen, was Gott, das Göttliche oder das Heilige sei, wird den Menschen nicht durch ein „Wittern" des Mysteriösen oder sonst ein persönliches Erlebnis, sondern durch die religiöse Gemeinschaft zuteil. C'est l'eglise, dont il est membre, qui enseigne á l' individu ce que sont ces dieux personnels etc. Auch die inhaltliche Bestimmung dessen, was heilig ist, ist Sache der religiösen Gemeinschaft und als solche der subjektiven Willkür entzogen. „Heilig" im religiösen Sinne kann immer nur etwas sein, was einer Glaubensgemeinschaft „heilig" ist, der Begriff des Heiligen setzt diese Gemeinschaft voraus. Kein Individuum, es sei denn, es handle als Repräsentant einer religiösen Gemeinschaft, kann etwas für heilig erklären. Verehrung des Heiligen ist keine Privatangelegenheit; wer „heilig" sagt, sagt in irgendeinem Sinne auch „Kirche". Und umgekehrt: wer keine im Glauben geeinte Gemeinschaft kennt oder anerkennt, für den gibt es im Grunde auch nichts Heiliges. Hier ist der Punkt, wo der Zusammenhang des Heiligen mit dem Kult sich als wesentlich erweist; denn die Religion der Gemeinschaft findet im Kult ihren eigentlichen Ausdruck . . .
Söderbloms Satz: „Fromm ist der, für den es etwas Heiliges gibt", enthält darum nur eine halbe Wahrheit; er muß ergänzt werden durch die Feststellung, daß das Heilige an die Gemeinschaft eines Glaubens gebunden ist und nur in dieser gilt, daß es also nichts gibt, was an und für sich, außerhalb einer solchen Gemeinschaft, heilig wäre oder es, etwa durch die erfahrungsmäßige Konstatierung eines einzelnen, werden könnte."
- ) Walter Baetke in: „Das Heilige im Germanischen", Tübingen 1942, S. 33 ff. Diese allgemeinen Ausführungen werden konkret belegt in Baetkes Schrift „Religion und Politik in der Germanenbekehrung", Leipzig 1937. Die franz. Zitate entnimmt der Verfasser Emile Durkheim «Les formes élémentaires de la vie religieuse», 2. Aufl. 1925.
Aus diesen wenigen religionswissenschaftlichen Überlegungen ergibt sich ohne weiteres, wie abwegig und sachlich verfehlt es ist, von Religion als Privatsache zu sprechen. Bei echten Religionen handelt es sich um objektive Gegebenheiten und nicht nur um Gefühl, Gestimmtheit und innere Anständigkeit.
In seinem Buche „Martin Luther und die Reformation im Urteil des deutschen Luthertums, Freiburg 1950", weist Walter Zeeden nach, wie auf dem Tiefpunkt einer Entwicklung von G. E. Lessing die Wahrheitsfrage der Religion von ihrer Betätigung in der „Tugend" vollständig abgetrennt wurde. Die Relativität aller Konfessionen und Lehrsysteme wurde bedenkenlos behauptet. Das Aufgeben der einen Wahrheit führte dann zu der so hoch gepriesenen sogenannten dogmatischen Toleranz, die für eine wirkliche Religion nicht in Frage kommen kann.
Und wenn wir uns schließlich vergegenwärtigen, daß Friedrichs d. Gr. sprichwörtlich gewordene Toleranz aus seiner im folgenden wiedergegebenen Meinung herrührt: „Betrachtet man die Religionen als Philosoph, so sind fast alle gleich. Immerhin verdient der Glaube, der am wenigsten mit Aberglaube behaftet ist, den Vorzug vor den übrigen", leuchtet es ein, daß die Verbannung der Religion in die Privatsphäre aus Gründen aufsteigt, die ihren Ort in unverfälschtem Liberalismus und in der Relativierung jeder Wahrheit haben.
Aus den soeben gewonnenen Erkenntnissen leiten wir ab:
- Religion als Prinzip besagt, daß alles Gemeinschaftsleben in der letzten Verantwortung steht. Durchzieht Religion wie ein roter Faden das ganze Leben, so versteht es sich, daß mit „Religion" auch der konfessionelle Charakter der Korporationen gemeint ist. Es gibt nur eine Wahrheit. Erziehung muß vom Höchsten und Heiligsten her ihr Richtbild empfangen, geschlossen und ohne Zer rissenheit erfolgen und die Lebenskräfte in Empfang nehmen und einsetzen, die Gott in seiner Selbsterschließung mitgeteilt hat. Wird Religion ernstgenommen als die Seinsbeziehung des Geschöpfes zum Schöpfer, eignet ihr größte Verpflichtungskraft. Man kann nicht eine Stunde sich in der Kirche als Christ betätigen und in der anderen nur als edler, hilfreicher Mensch leben.
Ist Religion von Wesen aus Gemeinschaftssache, dann muß sie auch in Lebensgemeinschaften den gebührenden Platz einnehmen und prägende Kraft auswirken.
Religion sagt weiterhin, daß Glaubensgemeinschaft in eine Linie zu setzen ist mit Kult- und Opfergemeinschaft. Gemeinschaftlicher Vollzug 'der Religion gehört also zu jeder Korporation, die „Religion" zum Prinzip hat. Eine Korporation ohne das Einende und im tiefsten Verbindende wird ein Geselligkeitsklub, bar der Kraft einer tragenden Lebensgemeinschaft. Gerade in unserer säkularisierten Zeit, in der der Christ — zumal an der Universität — inselhaft leben muß, sollen der Aktive und der Alte Herr in ihrer Gemeinschaft katholische Luft atmen können, um in der Isolation zu bestehen. Bundesbrüder, im letzten durch den Taufbund geeint, stützen einander in ernsten und frohen Stunden. Jeder ist besorgt, daß der Kom-militone nicht unterliegt, nicht vom Weg abirrt, sich nicht vom Gottwidrigen gefangen nehmen läßt. Dieses Wollen muß letzte Grundhaltung sein, wiewohl ein Mann aus Schamhaftigkeit davon wenig Worte macht.
Es ist ganz entschieden abzulehnen, die religiöse Vertiefung allein in die Studentengemeinde zu verlegen. Die Korporation muß in eigener Aktivität die wesentlichen Grundlagen christlicher Existenz und das lebendige Christsein als ihr innerstes Einheitsband erkennen und erfahren.
Als unerläßliche Aufgabe wird es jeder Korporation vor Augen stehen müssen, in eigener Initiative oder mit Unterstützung des Studentenpfarrers, theoretisch und praktisch in religiöses Leben einzuführen. Erübrigt ein Verein dafür keine Zeit, weil das Gesellschaftliche den ersten Rang einnimmt und alles beherrscht, dann muß er soviel Ehrbewußtsein aufbringen, aus dem Verband auszuscheiden, der vor aller Welt auf seine Fahnen als erstes Prinzip „ Religion" geschrieben hat.
Als praktische Konsequenz ergibt sich, daß zielstrebige religiöse Bildungsarbeit im Semester geleistet werden muß. Eine Zusammenfassung und eine Ergänzung hat an einem Tage religiöser Besinnung zu erfolgen. Diese bewußte religiöse Bildungsarbeit ist leicht abzustimmen auf die Vorträge und Veranstaltungen der Studentengemeinde.
Gibt sich jede Korporation redliche Mühe, Akademiker heranzubilden, die als zuverlässige Katholiken im Berufsleben ihren Mann stehen und sich in stützender Freundschaft einander verbunden wissen, dann werden Verkennung und Argwohn von vornherein gegenstandslos.
So oft ist von studentischer Ehre die Rede. Katholischen Korpo-rierten muß ein feines Ehrgefühl und ein klares Bewußtsein eigen sein, das sie zur wahrheitsgemäßen Haltung drängt.
Literaturhinweise Adam, Karl Das Wesen des\Katholizismus Schwann-Verlag, Düsseldorf
Adam, Karl Jesus Christus, Schwann-Verlag, Düsseldorf Beumer, Johannes Auf dem Wege zum Glauben. Eine katholische Apologetik für Laien. Knecht-Verlag, Ffm. 1956 Brunner, August Religion. Verlag Herder, Freiburg/Brsg. Guardini, Romano Die Offenbarung, ihr Wesen und ihre Formen. 135 S. Werkbund-Verlag, Würzburg.
Hartmann, Albert Toleranz und christlicher Glaube. Verlag J. Knecht, Frankfurt a. Main, 1955 Schmaus, Michael Das Wesen des Christentums. Ettal Weite, Bernhard Vom Wesen und Unwesen der Religion, 44 S. Verlag J. Knecht, Frankfurt a. Main Weite, Bernhard Gemeinschaft des Glaubens. 37 S. Verlag J. Knecht, Frankfurt a. Main Wissenschaft Freiherr von Hertling führte in seiner Prinzipienrede, wie man seine Darlegungen auf dem Katholikentag 1863 genannt hat, aus: „Auf allen Gebieten der Wissenschaft gilt es zu zeigen, daß die Resultate einer aufrichtigen, unbefangenen Forschung stets und immer in vollster Harmonie stehen mit den Lehren der Offenbarung. Indem die Vereine den Einzelnen „bewahren vor Zersplitterung und Verflachung, verleihen sie seinem wissenschaftlichen Bestreben die höhere Weihe!" Es ist leicht einzusehen, daß mit dem Prinzip Wissenschaft das gemeinsame Bemühen im wissenschaftlichen Streben nach Wahrheit, das Austauschen der Kenntnisse von Angehörigen der einzelnen Fakultäten und die gegenseitige Förderung in der Zusammenschau von Glaube und Wissen gemeint sind. Soll das zweite Prinzip ganz zutreffend interpretiert werden, muß man im Auge behalten, daß alles Suchen und Forschen nach Wahrheit zum Urquell alles Wahren hinführt. Unerläßliche Voraussetzung ist allerdings das echte Ethos. Wissen allein genügt nicht. Ein gebildeter, ein tiefer Mensch wird man nicht durch das Wissen, das man hat, sondern durch die Grundhaltung, aus der heraus man lebt.
Wissenschaft als Prinzip besagt: Die Ordnung der Dinge d. i., den Kosmos erkennen und sich selbst ordnen, sich selbst ins rechte Einvernehmen bringen, „die Wahrheit tun".
Besser als in Begriffen und allgemeinen Erörterungen wird in der Hl. Schrift, in der Gestalt des Akademikers Nikodemus, das dem wissenschaftlichen Bemühen zugeordnete Ethos, der Vorgang lauteren Suchens erkennbar, mehr noch: plastisch veranschaulicht:
Durch die nachtdunklen Straßen Jerusalems geht ein Mann, das Herz voller Unrast. Er sucht eine Begegnung mit jenem fremden Rabbi aus der Provinz Galiläa. Dieser bisher Unbekannte aus dem entlegenen Winkel Nazareth hat ihn, den jüdischen Ratsherrn und Hochschullehrer, unruhig gemacht. Seine Worte und wunderhaften Werke lassen ihn nicht in der Stille der Studierstube.
Er kommt des Nachts zu Jesus. „Meist wird angenommen, daß es aus Furcht vor den übrigen Mitgliedern des Hohen Rates geschah. Dies wird jedoch mit keiner Silbe angedeutet und ist zu Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu auch nicht wahrscheinlich." (A. Wiken-hauser) Nikodemus, der Mann mit seinen reichen Lebenserfahrungen, hat viel nachgedacht, und als Ergebnis seiner Überlegungen spricht er es aus: „Meister, wir wissen, daß du ein gottgesandter Lehrer bist; denn die Wunder, die du wirkst, kann niemand wirken, wenn nicht Gott mit ihm ist." Auf sein schlußfolgerndes Denken geht der Herr nicht ein.
Da ist ein suchender, williger Mensch, und Christus offenbart ihm unvermittelt das große Lebensgeheimnis: „Wenn einer nicht wiedergeboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht schauen." Der bekannte Lehrer ist Lernender geworden. Den Kategorien rein irdischen Denkens verhaftet, stößt er sich an der Forderung einer Wiedergeburt. „Wie kann ein Mensch, der bereits ein Greis ist, geboren werden? Kann er etwa ein zweites Mal in den Mutterschoß eingehen und geboren werden?" Doch Jesus übernimmt die Führung des Gespräches. Nikodemus ist nunmehr Hörer. „Wahrlich, wahrlich ich sage dir, wer nicht geboren wird aus Wasser und Geist, kann nicht in das Reich Gottes eingehen! Wer aus dem Fleische geboren wird, ist Fleisch, wer aber aus dem Geiste geboren wird, ist Geist." Was bedeutete eine Wiedergeburt, wenn sie auch oftmals sich wiederholte! Alles, was in dieser Welt geschieht, ist der Vergänglichkeit und dem Tode unterworfen. Wer aus dem Wasser und dem Geiste wiedergeboren wird, empfängt ein neues Lebensprinzip, das nicht mehr dem Tode verfallen ist. Es kommt von oben herab, aus Gottes Lebenswelt; im Kosmos findet es sich nicht. Heiliger Odem Gottes ist die Lebensgabe, und darum kann von Geburt aus dem Geiste die Rede sein. Erneut fällt es Nikodemus schwer, der Entfaltung des großen Geheimnisses zu folgen. Der Herr verweist ihm sein mangelndes Verständnis. Als Hochschullehrer müßte er aus dem Alten Testament die prophetischen Verheißungen über das Wirken des Hl. Geistes kennen. „Wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muß der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das
ewige Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe." Alles mes-sianische Heil und Leben ist ein Gnadengeschenk von oben. Gottes Liebe ließ Seinen eingeborenen Sohn dahingehen. Die Hingabe, die Erhöhung des Menschensohnes am Kreuze ist die Voraussetzung der neuen Geburt aus Gott.
Jene nächtliche Unterredung ging zu Ende. In Gedanken versunken geht Nikodemus heim. Doch der Nazarener läßt ihn nimmer los. Sein Wort, seine Taten, seine Persönlichkeit haben sich ihm nachhaltig eingeprägt. Da meint er, alles Gewölk sei zerstoben, und schon dräuen erneut düstere Zweifel. Er bejaht und verwirft, Gefühl und Verstand bedrängen einander. Er weiß sich der Wahrheit pflich-tig und darum tritt immer wieder die Gestalt Christi fordernd und Entscheidung heischend vor seine Seele hin.
Offenkundig wird die Reinheit seiner Gesinnung, die Wahrhaftigkeit seines Wesens, als Nikodemus in einer Sitzung des Hohen Rates für Wahrheit und Recht eintritt. Man hatte Büttel ausgesandt, Jesus zu verhaften und vorzuführen. Unverrichteter Dinge kehren sie zurück. Ganz im Banne des fremden Rabbi geben sie als Grund an: „Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser" (Jo 7, 46). Die Pharisäer sind aufgebracht und stellen spöttisch die Frage, ob sie in gleicher Weise wie das naivgläubige, gemeine Volk sich hätten betören lassen. Man verschanzt sich hinter das Gesetz und seine Kenntnis. „Habt auch ihr euch verführen lassen? Glaubt denn einer von den Vorstehern oder Pharisäern an ihn? Nein, nur dieses verfluchte Volk, das vom Gesetz nichts versteht." Furchtlos erhebt sich Nikodemus, tritt wider allen Dünkel für die Wahrheit ein und macht geltend, daß das Gesetz die Verurteilung eines Menschen verbietet, ehe man ihn gehört und den Tatbestand festgestellt hat. Seine Kollegen sind nicht mehr der Wahrheit als solcher erschlossen. Sie haben ihre vorgefaßte Meinung, sie prüfen nicht, sie ringen nicht mehr, wissen sich nicht der lauteren Wahrheit verpflichtet. Wie treffend ist der Satz des Evangelisten: „Dann gingen sie auseinander, ein jeder in sein Haus!" (Jo 7, 43) Dort, wo Nikodemus Unrecht klar erkennt, gibt es für ihn kein Zögern. Er sucht die Wirklichkeit und strebt Objektivität an. Der angesehene Ratsherr scheut nicht den Widerspruch und die Gegnerschaft seiner Amtsgenossen. Recht muß Recht bleiben, auch im Falle des Nazareners, ob man bedenkenlos sich gegen ihn entschieden hat oder sich noch um eine Klärung seines Anspruches und seiner Botschaft bemüht! Wer redlich um Wahrheitserkenntnis ringt, auch im öffentlichen Leben für die Wahrheit Zeugnis gibt, wie Nikodemus beispielsweise im Hohen Rat, wird von Gottes Gnade geführt und geleitet.
Der Ratsherr gelangt zum Glauben an Den, Der die Wahrheit selber ist. Er wird gewürdigt, Ihm, der Weg, Wahrheit und Leben ist, den letzten Dienst der Liebe zu erweisen. In Gemeinschaft mit Joseph von Arimathäa, von dem die Schrift sagt, daß er aus Furcht vor den Juden ein heimlicher Jünger Jesu war (Jo 19, 38), bestattet er den HERRN. Der Gelehrte bringt eine Mischung von Myrrhe und Aloe. Wohlriechendes Harz und wohlriechendes Holz sollen den Verwesungsgeruch bekämpfen. Nikodemus stört sich nicht an der gesetzlichen Unreinheit. In einsamem Entschluß stellt er sich eindeutig auf die Seite Jesu. Welch bewundernswertes Ethos besitzt dieser Mann! Nach Wahrheit forschen, wissenschaftliches Bemühen, Mitarbeit im Staate sind ihm Lebenselement. Er hat die Position als Hochschullehrer und Mitglied des Hohen Rates und scheut sich dennoch nicht, zu dem jüngeren Unbekannten hinzugehen und hinzuhorchen. Nikodemus kommt aus einer anderen Schicht als die einfachen Fischersleute vom See Genesareth. Er bedeutet etwas in der Öffentlichkeit, er hat etwas zu verlieren. Und doch! Ohne falsche Rücksicht und Scham sucht er nach der Wahrheit. Er bekennt sich zu Recht und Gesetz ohne Furcht vor irgendwelchen Konsequenzen. Er macht es nicht wie jene aus den führenden Kreisen des Volkes, von denen der Evangelist Johannes schreibt: „Sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott". (Jo 12, 43) Ist Nikodemus, der Hochschullehrer und jüdische Ratsherr, nicht Vorbild für den christlichen Akademiker? Wer wie er Wahrheit sucht, sich ihr verpflichtet weiß im Willen zur Objektivität und sie nicht niederhält (vgl. Rom 1, 18), gelangt im Mitwirken mit der Gnade zu Christus, der Wahrheit in Person. Wer in die Wirklichkeitsprovinzen auf der Suche nach Wahrheit eindringt und opferwillig für sie einsteht, entdeckt schließlich auch den Schöpfer aller Wahrheit und Wirklichkeit. Am Schluß des Berichtes von jener Nikodemus-stunde schreibt der Evangelist: „Wer aber nach der Wahrheit handelt, kommt zum Lichte, damit offenbar wird, daß seine Werke in Gott getan sind." Muß von dieser biblischen Sicht her nicht „Wissenschaft" einen neuen Sinn und „Wissenschaft" als zweites Prinzip einen neuen Glanz erhalten?
Bildung, Tiefe, Innerlichkeit, ernstes Studium, lauteres Ethos und Gottbezogenheit — all das ist beschlossen im Prinzip „Wissenschaft". Da wird deutlich, welch innerer Zusammenhang zwischen dem ersten und zweiten Prinzip besteht, und wie das eine in das andere hinein greift. Ob wir der „Wissenschaft", der wissenschaftlichen Weiterbildung, der Vertiefung unserer Weltanschauung genügend Raum geben? Unser Weltbild darf nicht durch Entgegennehmen von Vorträgen, von Funk- und Filmberichten, von Zeitungsmeldungen und -artikeln, von Darstellungen in Frage und Antwort zustande kommen. Sind Referate von Aktiven eine Seltenheit? Lassen wir sie uns von Alten Herren in buntem Allerlei mundgerecht vorsetzen? Fehlt nicht häufig der gute Wille, wenigstens einen bedeutsamen Aufsatz sich wirklich zu erarbeiten? Gewiß gibt es heute eine Vielzahl von Bildungsgelegenheiten innerhalb und außerhalb der Hochschule. Man denke nur an die geordnete Form nachdrücklicher Studentenseelsorge heute! Wissenschaftliches Bemühen im Rahmen einer Korporation, Weiterbildung innerhalb eines Altherrenzirkels bedeuten indes ein Aneignen wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Wie fordernd das zweite Prinzip für den ganzen Verband ist, geht allein schon aus der Tatsache hervor, daß die ältesten Korporationen des KV ihr Entstehen einem Katholischen Leseverein verdanken, der sich seinen Statuten Gemäß zum Ziel gesetzt hat, „das allgemeine Interesse für Katholisches Leben, Kunst und Wissenschaft unter seinen Mitgliedern rege zu halten und dieselben so viel wie möglich durch Halten und Lesen von dieser Richtung entsprechenden Zeitschriften zu fördern." Die Bonner Arminia schreibt in ihren Statuten von 1863, „daß ihre Mitglieder ihre allgemeine Bildung durch gegenseitigen Austausch selbständiger wissenschaftlicher Leistungen fördern." Literaturhinweise Bernhart, J. Wissen und Bildung Zwei Vorträge, Stufen des Wissens Bildung in dieser Zeit Kösel-Verlag, München 1955 Guardini, R., Der unvollständige Mensch und die Macht, Würzburg 1956 Pieper, J., Was heißt akademisch? Kösel-Verlag, München Sellmair, J., Bildung in der Zeitenwende. Echter-Verlag, Würzburg 1951
Konfessionelle Korporationen ? Da im wesentlichen die gleichen Gründe für die Konfessionalität der Korporationen sprechen wie für die Konfessionsschule, sei folgender Auszug aus Joseph Bernhart, Wissen und Bildung, S. 77 f., Kösel-Verlag, München, wiedergegeben.
Fester Boden ist nur noch dort, wo man in allem Gerede von christlicher Kultur das Halten zu Christus selbst — es komme, was da wolle — als ihr Fundament erkennt. Suchet das Reich, das andere wird euch dazugeworfen. Nur innerhalb eines solchen Weltverständnisses aus Christus und seinem Evangelium kann auch das Bildungsleben die Orientierung auf eine feste Mitte empfangen, einen Beziehungspunkt für alle die schwimmenden Inseln von Bildungsprogrammen mit ihren Fähnchen so verschiedener Couleur. Aber das erste Gefühl dafür, daß die Gebiete des Wissens alle zusammenhängen, sollte schon in der ersten Schule der Jugend erwachsen. Dieses Prinzip des Organischen in alledem, was die Schule vermittelt, wird aber nirgend besser geborgen sein als in der Konfessionsschule. Das ist theoretisch und grundsätzlich eine Wahrheit, die als solche nichts an Gültigkeit verliert, wenn Konfessionsschulen sie faktisch und praktisch nicht erfüllen. Sie hätten die Aufgabe, den jungen Menschen fühlen zu lassen, daß die verschiedenen Gebiete des Unterrichtes nichts weniger als Fächer sind — wie Fächer eines Schrankes, die einander nichts angehen —, sondern die Äste und Zweige und Blätter eines Baumes, der als Ganzes aus einem Ganzen lebt. Die Stunde, in der gerechnet wird, die andere, die der Sprache, die dritte, die der Geschichte gilt, und jede andere mit ihrem besonderen Gegenstand sinnbilden alle etwas von dem Kosmos menschlichen Geistes, durch den der Mensch das Ebenbild seines und aller Dinge Schöpfers ist. Das kann die Jugend noch nicht überschauen, es braucht ihr begrifflich auch nicht klar zu werden, aber ich glaube, wenigstens dunkel spürbar läßt sich's machen, wie alles dies, die Welt der Zahl, des Wortes, der Kunst, der Pflanzen und Tiere, der Naturkräfte und der menschlichen Vergangenheit und lebendigen Gegenwart in dem einen, alles wirkenden Gott zusammenhängen. Dazu aber hat die Konfessionsschule die kostbare Möglichkeit: sie hat es in der Hand, die stille Beziehung jeglicher Stunde zur Religionsstunde fühlbar zu machen. Je diskreter es geschieht, um so besser. Aber alles kommt darauf an, schon durch den Einfluß auf den erwachenden Intellekt das erste Notwendige zu erwecken: die Ehrfurcht. Wo sie fehlt, kann es nie zur Bildung kommen — denn wie man ihren Begriff auch bestimmt: ohne dieses elementare Humanum trifft er nicht das, was er durch zweitausend Jahre trotz aller Wandlungen des Denkens über Mensch und Welt besagt hat.
III. Freundschaft Es ist sehr aufschlußreich, daß in den Statuten anfänglich von „studentischer Geselligkeit" als drittem Prinzip die Rede war und bei deren Revision 1880 das Wort „Freundschaft" an die Stelle rückte. Diese Entwicklung läßt sich verstehen aus der Situation der Gründerjahre, wo eine verhältnismäßig kleine Anzahl katholischer Studierender sich zusammenfand. Religion war ihnen Herzenssache, sie zu leben, sich darin zu vertiefen und dafür einzustehen, war ihr gemeinsames Bestreben. Wissenschaftliches Bemühen einigte sie als Studierende, die die ganze (katholon) katholische Wahrheit suchten. So ergab es sich, daß die Wenigen über das ernste Anliegen hinaus gemeinsam sich entspannen und miteinander fröhlich sein wollten. Das rasche Anwachsen der Korporationen brachte es mit sich, daß das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit verblaßte, die innere Verbindung sich lockerte. Die Pflege von Religion und Wissenschaft allein ließ keine Gemeinschaft aufkommen, die auch das gesellschaftliche Leben in sich einbezog.
Wer kritisch an das Prinzip „Freundschaft" herantritt, wendet ohne weiteres ein: Wie soll Freundschaft eine Vielzahl von Männern verbinden, so ganz verschieden in ihrer Art, den verschiedensten Lebensaltern zugehörig? Freundschaft ist doch ganz persönlich und in der Regel nur zwischen zwei Menschen anzutreffen.
Wenn Freundschaft zum Prinzip des Verbandes bzw. der Korporation erklärt wird, dann soll damit zum Ausdruck kommen, daß die Zusammenhörigkeit einer Korporation — einer Körperschaft, die ihre Mitglieder wie die Glieder eines Leibes zu einer Lebensgemeinschaft zusammenhält — über Kameradschaft hinaus auch etwas von der Freundschaft an sich haben muß.
Freunde haben etwas Verwandtes in ihrem Wesen, in Sinn und Gespür, haben eine Antenne für bestimmte Schwingungen, empfinden und urteilen darum ähnlich. Gemeinsam ist ihnen das Lebensgefühl. In den Verschiedenheiten ergänzen sie sich einander.
Menschen, die für Religion und Wissenschaft sich einsetzen, die unermüdlich und unverdrossen dem einen Ziele zustreben, wie Soldaten Schulter an Schulter, sind Kameraden. Das Wissen um die Zuverlässigkeit des andern, um sein selbstloses „ich dien", schafft eine feste Werkgemeinschaft. Freundschaft aber besagt in Abhebung davon, daß gemeinsames Fühlen und Erleben vereint. Imponderabilien werden zu innersten Bindekräften. Man merkt es dem andern an, daß er zu einem paßt. Sind auch Unterschiede da, so kann die
Freundschaft sie stehen lassen, das Gemeinsame überbrückt sie. Es mag einer untadelig sein, durchaus tüchtig und gediegen, rechtwinklig an Leib und Seele, so ist darin noch nicht eingeschlossen, daß er unser Freund werde.
Wie tragend und kennzeichnend ist der Satz, den ohne Pathos, ganz beiläufig schier Raissa Maritain in ihrem Buch „Die großen Freundschaften" niederschrieb: „Unsere Freunde sind ein Teil unseres Lebens, und unser Leben erklärt unsere Freundschaft." Romano Guardini formulierte einmal denselben Sachverhalt in der Weise: „Einen Menschen bestimmt nicht nur, was er ist, sagen wir also seine Wesensgestalt, sondern was er gelebt hat, seine Schicksalsgestalt. Darin steht die Umgebung, in der er aufgewachsen ist, und das Bild der Eltern und Geschwister, das seiner Lehrer, Freunde, Gegner. Dieses Gewebe von Gestalten ist eingegangen in seine lebendige Faser, in das plastische Gedächtnis seines Lebens und seines Gemütes. Er lebt aus den Menschen, die in sein Leben eingetreten sind und es bestimmt haben. In jener Schicksalsgestalt steht ferner, was er getan hat und was ihm geschehen ist. Eine Tat, die er getan hat, ist damit nicht weggetan, sie lebt in ihm fort. Jedes Wort hinterläßt seine Spur im lebendigen Sein. Jede Begegnung, jede Erfahrung, reine und häßliche, bestätigende und hemmende, zeichnet sich ein. So lebt der Mensch in jedem Augenblick die Erbschaft des Vorausgegangenen." *) Gilt Freundschaft im Kartellverband als drittes Prinzip, so soll sie im Leben der Gemeinschaft als Dominante klingen. Alles zusammen soll hinauswachsen über reine Kameradschaft und sich echter Freundschaft nähern. Hier ist unseres Erachtens der Ort, das BC-Geheimnis sinnvoll und begreiflich zu machen. Diskretion ist in jedem Falle die unerläßliche Grundlage jeder Freundschaft. Es ist beschämend, feststellen zu müssen, wie weite Kreise sich nicht mehr der Gemeinschaft in gebührendem Maße pflichtig wissen. Wer die Geheimnisse eines Freundes enthüllt, verliert das Vertrauen und findet keine Freunde mehr . . . Denn wie ein Mensch, der seinen Freund zugrunde richtet, so ist, wer durch Vertrauensbruch die Freundschaft mit seinem Nächsten zerstört. (Sir. 27, 17 f.) Geht ein Freund nachwirkend in die Schicksalsgestalt des andern ein, ersteht ihm eine hohe, ernste Verpflichtung. So ist auch die Gemeinschaft der Korporation eine Gabe und Aufgabe zugleich.
•) Guardini, Vom Sinn der Gemeinschaft, Arche-Verlag, Zürich 1950, S. 21 f.
Freundschaft beinhaltet: Des Gefährten Nähe beglückend erfahren, sich mitverantwortlich wissen für den Weggenossen, der sich zugesellt, Sorge tragen.
Freundschaft, in den Studienjahren innerhalb der Korporation gewachsen, muß sich im Altherrenzirkel des Ortes über den Altherrenverein hinaus bewähren.
Als Zeichen der Freundschaft betrachten und bewerten wir die Hilfe und Förderung, die der Verband dem Freunde gewährt, ohne daß berufliche Qualitäten außer acht gelassen und bei andern übersehen werden sollen. Das Vertrauen des Freundes zum Freunde, das Vertrauen darauf, daß er den Geist des Verbandes sich angeeignet hat, spricht sich in der Berufshilfe aus.
Freundschaft erfaßt eigentlich nur der gereifte Mensch, weise geworden durch die Erfahrungen des Lebens. Dann, wenn sich die Erinnerung neben den gelösten, ergrauten Mann setzt und aus vergangenen Tagen erzählt, wenn die Bilder der Freunde kommen und gehen, eines nach dem andern, wird Freundschaft anschaulich und geht ins Gemüt. Den Reichtum der Freundschaft können nur alte Freunde ins Wort geben, wenn sie aus vielen Jahren gemeinsamen Erlebens sprechen.
„Gib den alten Freund nicht auf, denn der neue kommt ihm nicht gleich. Ein neuer Freund ist wie ein neuer Wein; erst wenn er alt geworden, trinkst du ihn mit Behagen." (Sir. 9, 14) Gott hingegeben, der Wahrheit erschlossen und verpflichtet, gehen Freunde ihren Weg. Ihre Freundschaft ist nicht Selbstzweck, sich nicht selbst genügsam. Echte Freundschaft ist angelegt auf den Ewigen. Sie kann in Dem nur Krönung finden, der die für Menschen un-überschreitbare Grenze der Fremdheit überwindet. Im Maße Freunde auf Gott zugehen, gehen sie aufeinander zu. Er ist die Mitte und die große Klammer. Er ist die Freundschaft selbst, da der Mensch sich und den Freund erst in Ihm versteht und zur bleibenden Einheit gelangt.
In diesem Ring „Religion, Wissenschaft und Freundschaft" ist die gesamte Größe menschlicher Existenz beschlossen. Gott weist uns den Weg zum Freund, zur Gemeinschaft, vertraut uns Wahrheit an und läßt uns wahrheitsgemäß in Liebe und Treue Ihm dienen. Leuchtend und mahnend stehen die schlichten Worte „Religion, Wissenschaft und Freundschaft" und sind imstande, einem studentischen Verband eine unvergleichliche Größe zu geben.
Der KV in seiner Erscheinungsform heute Zweifellos haben die Prinzipien des Verbandes zeitüberhobene Gültigkeit. Man wird zugeben müssen, daß auch das 1946 geschaffene Hardehausener Grundgesetz nur eine konkretere Entfaltung der Grundsätze katholischen Korporationsstudententums darstellt und eine Übereinstimmung im wesentlichen gegeben ist. Was einer Deutung bzw. Erläuterung bedarf, ist die heutige Erscheinungsform des KV als eines nichtfarbentragenden Korporationsverbandes.
Der KV als bündisch-korporativer Zusammenschluß Vom Beginn der Neuzeit ab waren die Studenten in wachsender Zahl bestrebt, nicht mehr in den Studentenwohnheimen, den sogenannten Bursen, zu wohnen, sondern als „freie Burschen" zu leben. Freiwillig bildeten sich zunächst Landsmannschaften, die als Gemeinschaften von Landsleuten den in der Universitätsstadt wohnenden Studenten Heimat schenken und Geselligkeit gewähren wollten. In Anlehnung daran gaben sich viele Korporationen ihren Namen. Dieses freiheitliche Element sollte dem Korporationsstudententum auch heute noch eigen sein. Es ist sehr fraglich, ob die von allen Seiten geförderten Wohnheime mit ihrer Hausgemeinschaft dem Korporationsleben zuträglich sind und ob unter geänderten sozialen Verhältnissen Studenten mit Vorliebe darin Wohnung nehmen. Jedenfalls war der Sinn für rechte Freiheit ein Charakteristikum des Korporationsstudententums.
Im Laufe weiterer Entwicklungen und Änderungen kristallisierten sich als Elemente bündisch-korporativer Lebensform heraus: Vorbereitungszeit (Fuchsenzeit), studentische Selbstverwaltung, Er-ziehungs- und Lebensgemeinschaft.
- Wer um Aufnahme bat, mußte zunächst eine Probe- bzw. Vorbereitungszeit auf sich nehmen. Ihre Herkunft ist leicht in der Probezeit, dem Noviziat des benediktinischen Mönchtums, zu erkennen. Ein gesundes Auswahlprinzip ist für eine Lebensgemeinschaft eben unentbehrlich, wenn nicht das Ganze gefährdet werden soll. Mag auch die Form einer Burschenprüfung vor der endgültigen Aufnahme in den Freundschaftsbund (man beachte, daß die Promotion feierlicher gestaltet wird als die Reception) problematisch sein, eine ernst zu nehmende Bedeutung ist ihr nicht abzusprechen. Von einer der Korporation gemäßen Grundhaltung und damit von einem grundlegenden Wissen kann nicht abgesehen werden. Der Maßstab für die Auswahl neuer Mitglieder ist charakteristisch für den Wert und die Selbstachtung einer Korporation.
- Studentische Selbstverwaltung, die heute in allen Schularten gefördert wird, darf als arteigene Form studentischen Gemeinschafts lebens auf besonderes Verständnis rechnen. Recht verstandene und geübte Freiheit — heute mehr denn je gefährdet — ist ein hohes Gut und wirklich eine Tugend. Soll die freie demokratische Staats form erhalten bleiben, ist das Einüben in der kleinen Gruppe einer Korporation eine vorzügliche Schule. Der Sinn für Freiheit, der Wille zur Mitverantwortung werden verlangt und geweckt. Von erziehe rischem Wert ist darum die Übernahme einer Charge = Last, Auf gabe, Amt. Von den Einzelnen werden faire Auseinandersetzung, Einhalten der parlamentarisch-demokratischen Spielregeln, Unter ordnung unter den Willen der Gemeinschaft gefordert. Die Kunst der Rede, der Diskussion und des Gesprächs kann hier gepflegt werden. Man wird gezwungen, den eigenen Standpunkt überzeugend zu ver treten und die Auffassung des anderen in gebührender Weise zu tolerieren.
Diese Seite des korporationsstudentischen Lebens kann fraglos den Willen und die Fähigkeit wecken zu verantwortlicher Mitarbeit in Staat und Kirche.
- Den Vorzug einer Erziehungs- und Lebensgemeinschaft heraus zustellen, bedarf es nicht vieler Worte. Wenn Bildung durch Umgang geschieht, dann vermag gemeinsames Bemühen den Menschen für die Lebenskreise des Berufs, des Staates zu fördern. Auch der Voll zug des Glaubens in der Gemeinschaft bringt Einübung und damit einen „Habitus" mit sich. Ähnlich wie der Weg zu rechtem Staats bewußtsein über die Familie geht, führt auch der Weg über die kleine Gemeinschaft einer Korporation zum Verband und darüber hinaus zu Kirche und Staat. Wer nie Freundschaft in kleinerem Kreise erlebt hat, ist nicht zur Beheimatung in einem Verbände oder in einem größeren Ganzen fähig.
Altherrenschaft In der heutigen Zeit, da die modernen Verkehrsmittel leicht große Entfernungen überwinden lassen, kann die Gemeinschaft über die Studienjahre hinaus viel leichter als früher erhalten bleiben. Manch tragende Kräfte entbindet darum ein Altherrenverein, obwohl man nur einige Male im Jahre zusammenkommt, allein schon durch das Bewußtsein der Verantwortung gegenüber den Bundesbrüdern, insbesondere den Aktiven.
Gerade in der industriellen Gesellschaft, wo der Mensch gar so schnell in der Anonymität untergehen kann, zeigt sich die Bedeutung eines Verbandes, der in den Altherrenzirkeln seine Angehörigen aufzufangen vermag, mit ihnen durch das Jahr geht, so daß
auch die Familien in die frohen und ernsten Stunden einbezogen werden. Mag bei einem Stammtisch nach des Tages Arbeit schließlich kein tiefgründiges Gespräch geführt werden, so erfolgt doch in der Regel ein Gedankenaustausch über die Tagesfragen aus katholischer Grundhaltung. Er bildet Meinung in dem nicht kleinen Einflußbereich des Akademikers. Bis in den religiös-kirchlichen Lebenskreis können somit der Altherrenverein und der Altherrenzirkel in gesunder Weise hineinwirken. Natürlich setzt das alles ein echtes Leben voraus, das sich nicht im rein Gesellschaftlichen erschöpft. Wer sich dafür verantwortlich weiß, muß immer wieder von neuem gegen Entmutigung angehen und kleine Erfolge schon frohen Herzens verbuchen.
Äußere Zeichen des Korporationsstudententums Wenn heute vom Korporationsstudententum die Rede ist, dann werden von vielen Seiten nur das Auftreten in Wichs , das Abhalten von Kneipen und Kommersen und „schwankende Gestalten" gesehen. In Wahrheit jedoch ist die äußere Form und höchst bedauerliche Zügellosigkeit nicht das Bestimmende für den katholischen Korporationsstudenten.
Zum Verständnis und zur Beurteilung des katholischen Korporationsstudententums ist aufschlußreich, daß von einer der ältesten katholischen Verbindungen der „Union" in Bonn, der „Romania", berichtet wird, daß sie sich auf keine feste Form von Mütze und Band, von Zirkeln und Namen des Zusammenschlusses (ob Verein, Verbindung oder Gremium) festgelegt hatte, ja Wichs und Schläger nicht besaß, wohl aber Schärpe und Cerevis.* Eindeutig und entschieden war die Haltung des Lesevereins zu Berlin. Er, der älteste Verein des KV, lehnte das Tragen äußerer Zeichen ab. Darum nimmt es nicht wunder, daß der junge Hertling trotz seiner Zugehörigkeit zur „Aenania" mit keinem Wort das Farbentragen erwähnte, sondern nur ausführte: „Alles, was die übernommenen alten Formen Gutes und Schönes in sich tragen, ziehen sie (gemeint sind die neuen Studentenvereine) mit Freuden in ihren Bereich und beleben sie zu frischem Glänze durch das Einflößen eines neuen geistigen Inhaltes." Daraus und aus der späteren Geschichte des KV wird erkennbar, daß alle korporationsstudentischen Formen für ihn nur eine sekundäre Bedeutung haben. Dies zeigt auch der Abbau vieler alten Formen heute und die ernste Suche nach neuen Wegen zur Gestal-
- ) Vgl. J. Weiß, An der Wiege der katholischen deutschen Studentenverbindungen, — Neues von der Bonner „Union", 1874 - 53 - 55, I. Bd., Der Weiße Turm, 1930.
tung der Zusammenkünfte und der festlichen Feier. Darin offenbart sich das Streben der jungen Menschen, den Begegnungen der Gemeinschaft einen zeitgerechten Ausdruck zu geben, ohne das überlieferte pietätlos und überheblich abzutun. Wohl sieht es der Verband als sinnvoll an, daß die Chargen besonders ausgezeichnet werden. Fahne und Wichs sind Symbole der Gemeinschaft. Für „Bilderstürmer" sei gesagt, daß die Menschheit zu allen Zeiten Symbole besaß. Den Staaten diente z. B. die Fahne als Integrationsmittel neben Hymne, Staatsoberhaupt u. ä. Einheit will erfühlt und erlebt werden! Einen offiziellen Beschluß, nur in dem sogenannten Salonwichs zu Chargieren (d. h. Schärpen und Cerevis, oder, was u. E. sinnvoller ist, „Barett" zu tragen), kennt der KV nicht. Den einzelnen Korporationen steht die Wahl frei. Die einen führen ins Feld, daß der Student auch heute noch den Degen sinnvoll tragen kann, als Zeichen des Einsatzwillens bis zum Tode. Sie sagen weiterhin, daß in der Zeit der polnischen Freiheitskriege die deutschen Studenten zum Zeichen der Verbundenheit und Sympathie mit den Freiheitskämpfern die Pekesche getragen haben. Sie vermöchte auch heute noch den Freiheitswillen zu symbolisieren. Die anderen lehnen das Chargieren in Vollwichs ab mit der Begründung, daß es Jahrzehnte hindurch Kennmal der Waffenstudenten gewesen und außerdem nicht mehr zeitgerecht sei. Die Tatsache, daß man auch heute noch den Vereinen die Entscheidung für Vollwichs oder Salonwichs überläßt, zeigt, daß der Verband diesen äußeren Formen nur eine zweitrangige Bedeutung beimißt.
Wenn sich im Korporationsstudententum, zum Teil von den Burschenschaften im Gefolge der Freiheitskriege herkommend, ein soldatisches Element findet und eine entsprechende Zucht verlangt wird, dann ist dies durchaus auch heute noch vertretbar und zu rechtfertigen. Unleugbar hat nach 1870 — es war der Staat Bismarcks — das Leitbild des preußischen Offiziers dazu beigetragen, dem äußeren Auftreten des Korporationsstudenten eine betont militärische Note zu geben.
Hier aber soll noch festgehalten werden, daß die jungen Männer, die sich über jede Gemeinschaftsbildung außer der von wirtschaftlichen Interessengruppen erhaben dünken, weithin dem Nihilismus verfallen und zu einer echten Begeisterung für Ideale nicht mehr fähig sind. „Ohne mich, aber alles für mich." Ein zuchtloser Haufen ohne Einsatzbereitschaft ist wahrhaftig nicht imstande, der gläubigen Kraft eines feindlichen Lagers gegenüber sich zu behaupten, geschweige denn eine neue Welt aufzubauen.
Der KV nichtfarbentragend Es ist höchst interessant, daß in der Gründerzeit des Bundes katholischer Studentenvereine bis zur Schaffung des CV und KV" die Studentenverbindungen und Studentenvereine in einem Korrespondenzverhältnis standen, während die farbentragenden Verbindungen für sich ein Kartellverhältnis gebildet hatten. Diese Gruppenbildung ist wohl die Hauptursache für den Auseinanderfall in zwei Verbände. Man staunt heute, wie friedlich-schiedlich die Trennung vor sich ging. Die Generalversammlung in Trier hatte zu deutlich geoffenbart, wie grundverschieden die Einstellung war. Auffällig ist, daß niemals u. W. von einer Auseinandersetzung über den Sinn des Farbentragens mit Gründen und Gegengründen berichtet wird. Für den Leseverein zu Berlin stand das Farbentragen nie zur Debatte. Arminia zu Bonn hat nach anfänglichem Kompromiß recht bald schon das Farbentragen vollständig abgeschafft und die Bezeichnung „Verbindung" mit „Verein" vertauscht. Auch die 1864 gegründete „Germania" zu Münster lehnte mit großer Mehrheit das Anlegen von Farben ab. Die Minderheit bestand zumeist aus jungen Semestern. Der Stifter, der stud. hist. Theodor Stahl, der in Berlin als Mitglied des Katholischen Lesevereins katholisches Studentenleben kennengelernt hatte, stellte bei den Verhandlungen erfolgreich den Antrag: „Es ist für alle Zukunft unstatthaft, daß Mitglieder des Vereins Farben tragen. Wer einen dahin zielenden Antrag stellt, ist ausgeschlossen." überhaupt zeigt die Geschichte des KV, daß der Ausbau des eigentlich Korporativen, die einläßlichere Übernahme des strukturellen Aufbaues, erst zu der Zeit vor sich ging, als die Studentenvereine an Zahl wuchsen und eine Gliederung mithin erfolgen mußte. „Idealismus und Reife der Anschauung" (Cardauns) waren zurückgegangen, so daß man der großen Gemeinschaft Stützen einzog und ihr in der korporativen Gliederung ein Gerüst gab, den Zusammenhalt zu sichern Immer jedoch hatte der Verband Männer in seinen Reihen, die eindringlich auf das Wesentliche hinwiesen und unbeirrt auf die notwendige Verwirklichung der Prinzipien drängten und damit eine heilsame Unruhe wachhielten.
Stellung zu Duell und Mensur Von Anfang an war es für den KV ganz selbstverständlich, Duell und Mensur abzulehnen. Die Lehre und Weisung der Kirche ist bis zur Stunde maßgebend geblieben. Ob eine Änderung in der „quaestio facti" eingetreten ist oder nicht, d. h. ob nach verändertem Sachver-
halt die Kirchenstrafe der Exkommunikation in Wegfall kommen könnte oder nicht, ist für die Einstellung des KVers belanglos. Nach der allgemeinen Lehre der Kirche ist jede Mensur, ob Sport- oder Bestimmungsmensur genannt, genau wie jedes gesundheitsschädliche Boxen dem inneren Gehalt nach gottwidrig und damit sündhaft. Mithin ist klar, daß für einen katholischen Studenten der Eintritt in eine schlagende Verbindung, auch wenn keine Verpflichtung zur Mensur besteht, nicht in Frage kommt. Zur näheren Orientierung sei auf „Herder-Korrespondenz" 9/1955, 277—286, hingewiesen. Darstellung und Form erscheint allerdings recht mangelhaft und darum sei mit der gleichen Dringlichkeit auf Jos. Fulko Groner OP., („Neue Ordnung" 2/1956, Jahrgang 1) und zur unerläßlichen Berücksichtigung auf die daran erfolgte Diskussion in „Neue Ordnung" „Um die Bestimmungsmensur" Heft 4/1956, Jahrgang 10, S. 243—245, verwiesen.
Die Aufgabe der Gegenwart Wenn der KV in den letzten Jahren in seinen offiziellen Stellungnahmen von manchem mißverstanden wurde, und vielerlei mehr oder minder heftigen Anfeindungen ausgesetzt war, dann hat das darin seinen Grund, daß trotz der verschiedensten Gesichtspunkte einhellig die Meinung herrschte: Die Weltsituation fordert, daß die katholischen Akademiker im Lebensgrund der Kirche verwurzelt, nicht abgekapselt leben, sondern als Glieder des Volkes Gottes (Laien) der Umwelt begegnen müssen. Der KV sieht es als seine besondere Aufgabe an, dafür Sorge zu tragen, daß der katholische Laie an seinem Ort in der Kirche, aus freien Stücken und mit innerer Teilnahme Verantwortung übernimmt. Religion und Leben heißt es miteinander zu verfugen und im gegebenen Rechtsstaat alle Kräfte einzusetzen, dem Reiche Gottes Raum zu schaffen.